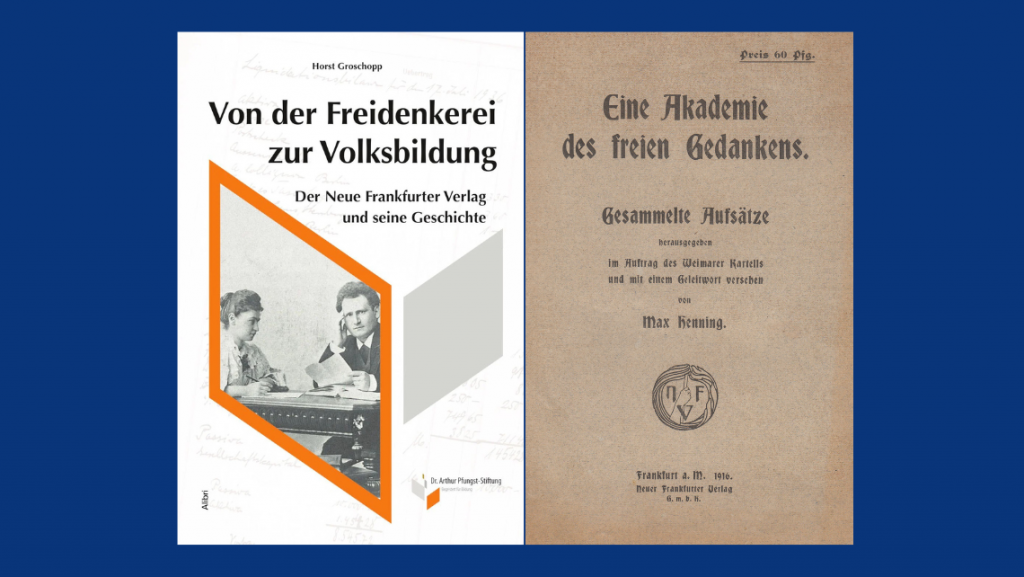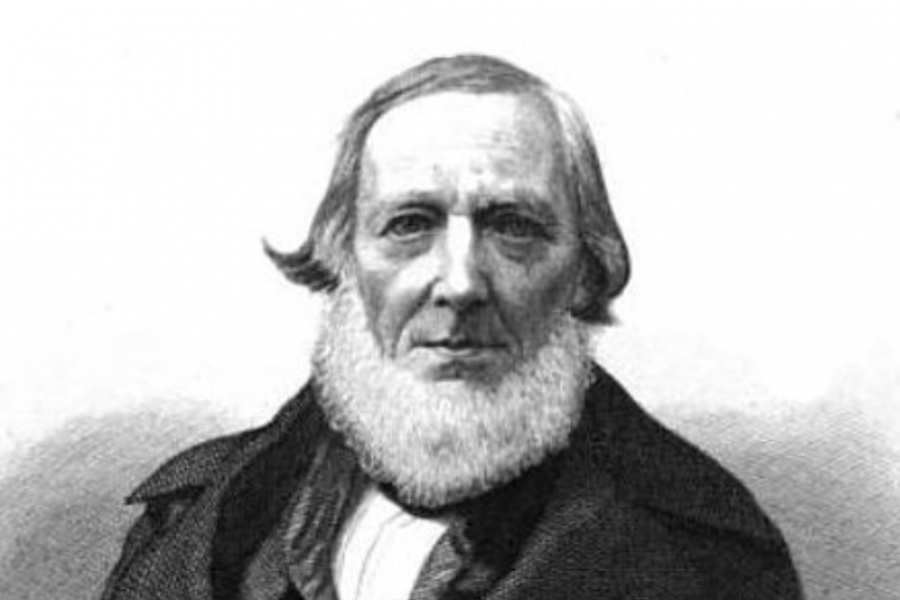Ein kleiner Raum irgendwo in den Staaten, unscheinbar, kahl. Ein Tisch mit Schaltern, ein Versuchsleiter im weißen Kittel. Ein Mann, der „Lehrer“, nimmt Platz und nimmt seine Anweisungen entgegen. Nebenan, durch eine Wand getrennt, sitzt ein „Schüler“. Für jede falsche Antwort, die dieser gibt, soll der „Lehrer“ ihm einen Stromstoß verpassen – und dessen Intensität nach jeder weiteren falschen Antwort erhöhen. Versuchsleiter und Schüler sind Schauspieler. Doch das weiß der Proband nicht, als er den passenden Knopf zur elektrischen Spannung drückt: 15 Volt, 30, 75, 150 … Schmerzensschreie ertönen aus dem Nachbarraum. Über dem letzten Knopf steht: „450 VOLT“. Der „Lehrer“ zögert. Soll er das hier wirklich fortsetzen? Der Mann im Kittel nickt. Fast beiläufig sagt er: „Das Experiment verlangt, dass Sie weitermachen.“
Es war kein Folterkeller, sondern ein normales Universitätslabor. Und doch drückten zwei Drittel der Versuchspersonen den fatalen Knopf bis zum Ende. Nicht aus Hass. Nicht aus Überzeugung. Sondern, weil jemand, der Autorität ausstrahlte, es von ihnen verlangte. Stanley Milgram wollte in den frühen 1960er-Jahren verstehen, wie gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen handeln. Sein Experiment, schlicht im Aufbau, massiv in der Wirkung, wurde zu einem Symbol für die Frage, warum wir gehorchen – und warum wir nicht damit aufhören, wenn genau dies das ethische Gebot der Stunde sein sollte.
Zwischen Vertrauen und Autorität
Ist Gehorsam per se moralisch verwerflich? Immerhin, so könnte man einwenden, trägt er dazu bei, Gesellschaften zusammenzuhalten, Ordnung zu schaffen und Kooperationen zu ermöglichen. Ganz ohne wäre ein funktionierendes Gemeinwesen schwerlich zu haben. Milgram ging es auch nicht darum, Folgsamkeit per se zu desavouieren. Stattdessen konnte er zeigen, wie dünn die Linie ist, die Vertrauen in Autoritäten von Unterwerfung trennt. Ein Tonfall, ein Kittel, ein institutioneller Rahmen – und schon setzt Routine ein und das eigene kritische Denken aus – zusammen mit der Fähigkeit, entsprechende Konsequenzen für wertegeleitetes Handeln zu ziehen.
Der Kontext entscheidet
Hannah Arendt bezeichnete es als „Banalität des Bösen“: die erschreckende Normalität, mit der Menschen Unrecht tun können, sobald sie ihre Verantwortung delegieren. Milgrams Laborversuch führte diese Einsicht experimentell vor. Er machte sichtbar, dass es weniger um „das Böse“ an sich geht, sondern um alltägliche Strukturen, die das Denken ersetzen und hinterfragendes oder gar widerständiges Handeln unwahrscheinlich machen. Allerdings konnten spätere Studien zeigen, dass solcher Gehorsam gebrochen werden kann, sobald a) der „Lernende“ sichtbar wird, b) die Autorität ihre Glaubwürdigkeit verliert oder c) jemand anders den Mut findet, sich zu widersetzen. Schon eine einzelne Person, die „Nein“ sagt, kann andere aus der Schockstarre lösen.
Sechzig Jahre nach Milgram streben autoritäre Regime und Bewegungen, die antihumanistisch, antiaufklärerisch und allem Fremden gegenüber feindselig aufgestellt sind, massiv an die Macht. Umso wichtiger, dass Milgrams Arbeit daran erinnert: nicht die Natur des Menschen ist gefährlich, sondern die Kontexte, in denen wir leben und die wir schaffen – nicht nur in extremen Verhältnissen, sondern in der ganz normalen gewöhnlichen Alltäglichkeit. Kreieren wir Situationen und Systeme, die Widerspruch unterdrücken, oder solche, die Zweifel zulassen? Es ist an uns, uns immer wieder neu für Letztere zu entscheiden.