Angelica Balabanoff wurde vermutlich am 8. Mai 1865 in Kiew in eine angesehene jüdische Bürgerfamilie hineingeboren. Mit 17 Jahren musste sie wegen ihrer revolutionären Einstellung und Tätigkeit das zaristische Russland verlassen. Sie studierte in Brüssel, London, Leipzig, Berlin und Rom Geisteswissenschaften. Kurz vor der Jahrhundertwende wurde Italien ihre politische Wahlheimat, wo sie bald in den Parteivorstand der Sozialistischen Partei gewählt wurde. Wie viele andere bezeichnete sie sich als nicht religiös gebundene Jüdin.1910 war sie eine der Vertreterinnen der italienischen SozialistInnen auf dem internationalen Kongress in Kopenhagen. Sie wurde Wegbegleiterin von Mussolini, der damals Chefredakteur der sozialistischen Zeitung „Avanti“ war. Ihre und Mussolinis Wege trennten sich, als Italien in den Ersten Weltkrieg eingetreten war und Mussolini sich zum kriegshetzenden Patrioten entwickelte.
Sie emigrierte in die Schweiz, organisierte gemeinsam mit Lenin und Trotzki den Widerstand gegen den Krieg und bereitete die bolschewistische Revolution vor. 1917, nach der russischen Revolution, kehrte sie nach Russland zurück und wurde Spitzenfunktionärin der im März 1919 gegründeten Kommunistischen Internationale. Sie kämpfte gegen Stalin und bald geriet ihr orthodox-marxistischer Sozialismus auch in Gegensatz zu der leninistischen Auffassung vom Staat. Sie verließ 1921 Russland erneut und ging nach Wien, wo sie an der Spitze der italienischen sozialistischen EmigrantInnen den Kampf gegen den Faschismus führte.
Bereits in den 1920er Jahren wies sie in vielen Reden warnend auf die faschistische Gefahr hin. Vor dem drohenden Nationalsozialismus musste sie aus Österreich nach Amerika fliehen. Ende 1947 besuchte sie erstmals Italien, wo sie sich auf dem Sozialistenkongress für den demokratischen internationalen Sozialismus einsetzte.
Am 25. November 1965 starb „die Balabanoff“ in Rom. Sie wollte kein kirchliches Begräbnis und keine Kränze. Freunde, die ihr Streben nach einer sozialistischen Gesellschaft, nach Freiheit und der Menschenwürde teilten, sollten eine rote Nelke in ihr offenes Grab werfen.
Literatur:
Maria Lafont: The Strange Comrade Balabanoff: The Life of a Communist Rebel, Jefferson 2016.
Gisela Notz: Angelica Balabanoff (1878 – 1965): in: diess.: Wegbereiterinnen. Berühmte, bekannte und zu Unrecht vergessene Frauen aus der Geschichte, Neu-Ulm 2020, S. 154.


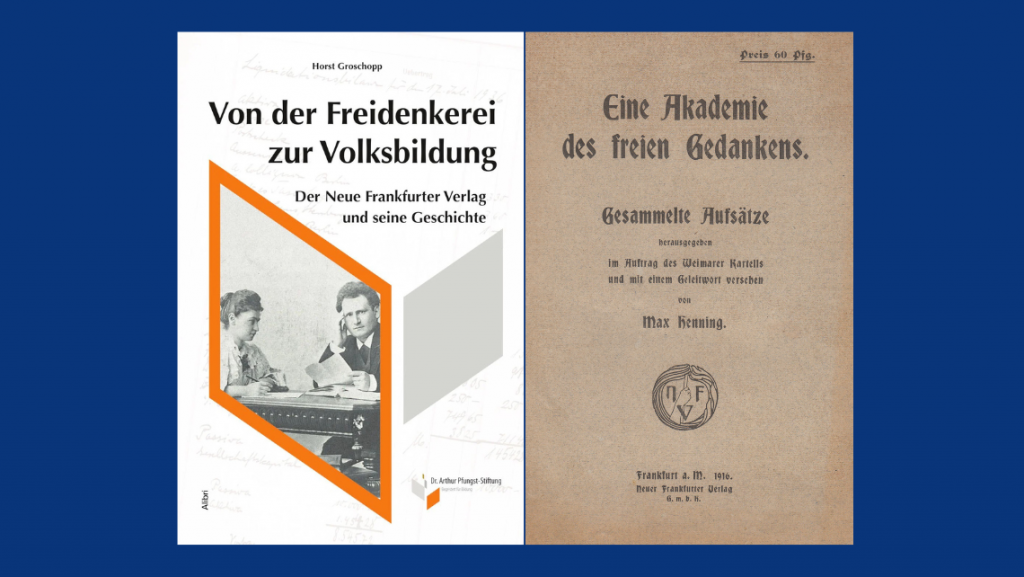


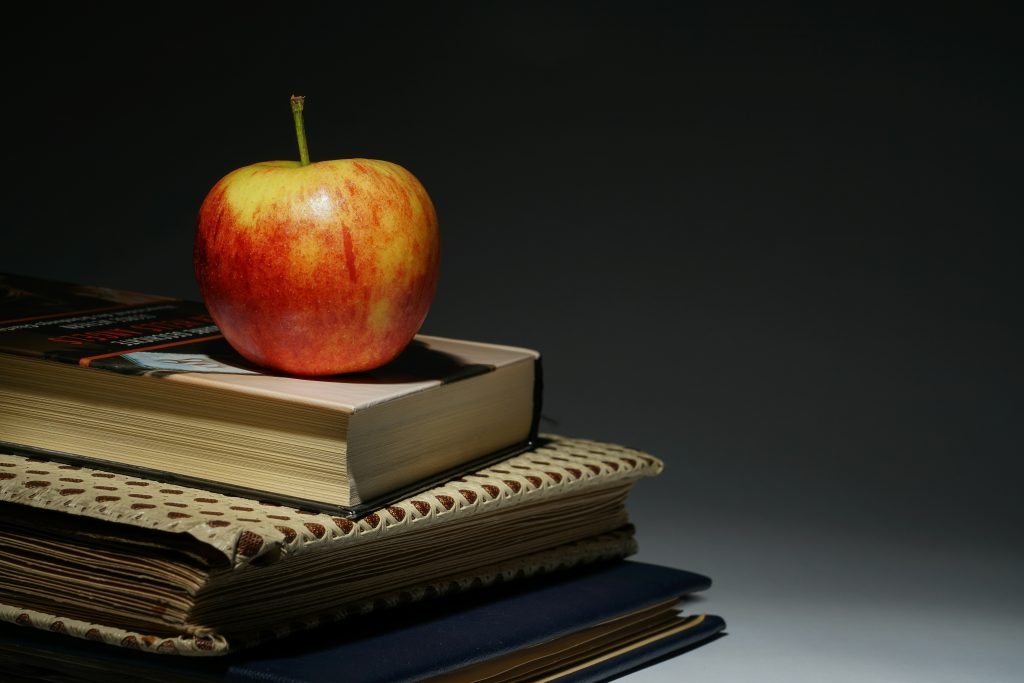

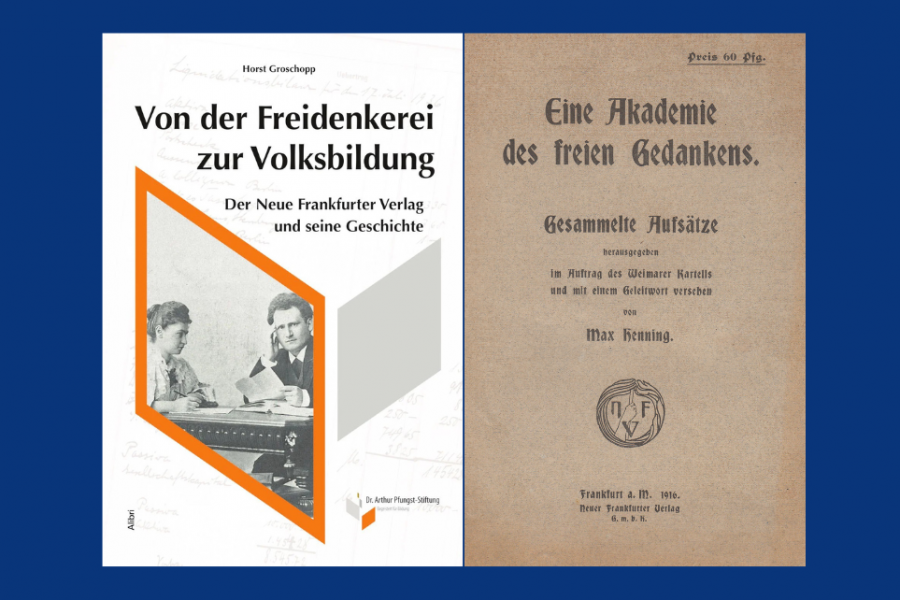
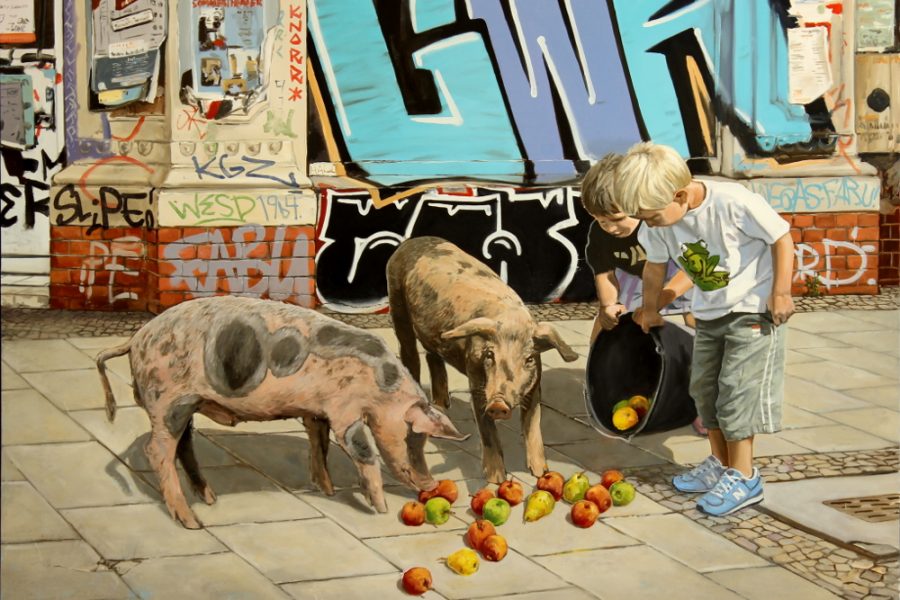

1 Gedanke zu „Eine mutige Kämpferin für Freiheit und Menschenwürde“
Alle Achtung. Wir sollten mehr auf Frauen hören!