Die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf ist keine radikale Außenseiterin. Sie steht für eine weltoffene Perspektive, wie sie im Sinne des Grundgesetzes selbstverständlich sein sollte. Dass sie dennoch zum Spielball politischer Machtinteressen wurde – unter Beteiligung von Akteur*innen, die sich offen gegen eine liberale Gesellschaft richten –, ist bedenklich.
Natürlich ist es legitim, dass bei der Berufung ans höchste deutsche Gericht auch weltanschauliche und ethische Haltungen eine Rolle spielen. Wie wir auf bestehendes Recht blicken, welche Fragen wir stellen, welche Grundrechte wir in den Mittelpunkt rücken – all das ist nicht neutral. Es ist geprägt von der Haltung und dem Menschenbild derjenigen, die Recht sprechen. Genau deshalb ist die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts keine bloß technische Entscheidung, sondern ein politischer Akt. Insofern stellt sich für mich auch die Frage, ob die eigene Argumentation von Frauke Brosius-Gersdorf – etwa in ihrem Auftritt bei Markus Lanz –, wonach es bei ihrer Nominierung ausschließlich um juristische Qualifikation und die methodische Herangehensweise an das Recht gehe, nicht zum Bumerang geworden ist. So nachvollziehbar und integer dieser Anspruch an Neutralität und Zurückhaltung im richterlichen Amt auch ist: Er unterschätzt möglicherweise die politische Realität, in der eine solche Berufung längst auch als weltanschauliche Positionsbestimmung verstanden wird – von Gegner*innen wie von Unterstützer*innen.
Was den Vorgang besonders ärgerlich macht: was wir aktuell erleben, ist keine faire demokratische Auseinandersetzung mehr. Es ist ein gezielter Versuch, eine bestimmte – nämlich liberale, menschenrechtsorientierte – Perspektive systematisch aus der höchsten juristischen Instanz herauszuhalten. Und das unter Beteiligung von Kräften, die sich nicht scheuen, aus religiösen Überzeugungen heraus Einfluss zu nehmen und zur persönlichen Diskreditierung beizutragen: Die medial wirksamen Äußerungen eines katholischen Bischofs sind irritierend, als sei es seine Aufgabe, mit moralischem Zeigefinger über Verfassungsrichterinnen zu urteilen. Viel schlimmer jedoch: Die Bühne dafür wurde ihm bereitwillig geboten. Dies ist kein Versehen. Es ist ein Symptom.
Es zeigt, wie stark die tradierten und einseitigen Verflechtungen zwischen Kirche, Medien und Politik noch immer sind – und wie diese in entscheidenden Momenten genutzt werden, um liberale Stimmen zu diskreditieren. Die Tatsache, dass eine qualifizierte Juristin am Widerstand einer sprichwörtlich unheiligen Allianz aus konservativen Meinungsmachern, politischen Strippenziehern und religiösen Funktionären scheitert, sollte uns alarmieren.
Denn der eigentliche Skandal liegt nicht in der Person Brosius-Gersdorf, sondern in der Angst vor ihrer Haltung. Es geht um die Verteidigung einer offenen Gesellschaft gegen jene, die diese Offenheit für gefährlich halten. Und um die Frage: Wer darf heute noch Richter*in in Karlsruhe werden – und wer nicht?
Der Fall Brosius-Gersdorf markiert einen Verlust. Nicht nur für eine engagierte Juristin, sondern für die Glaubwürdigkeit unseres demokratischen Selbstverständnisses. Und er sollte uns warnen: Wenn selbst die politische Mitte in Frage gestellt wird, weil sie nicht mehr in ein zunehmend illiberales Raster passt – wer schützt dann morgen noch den Rechtsstaat?


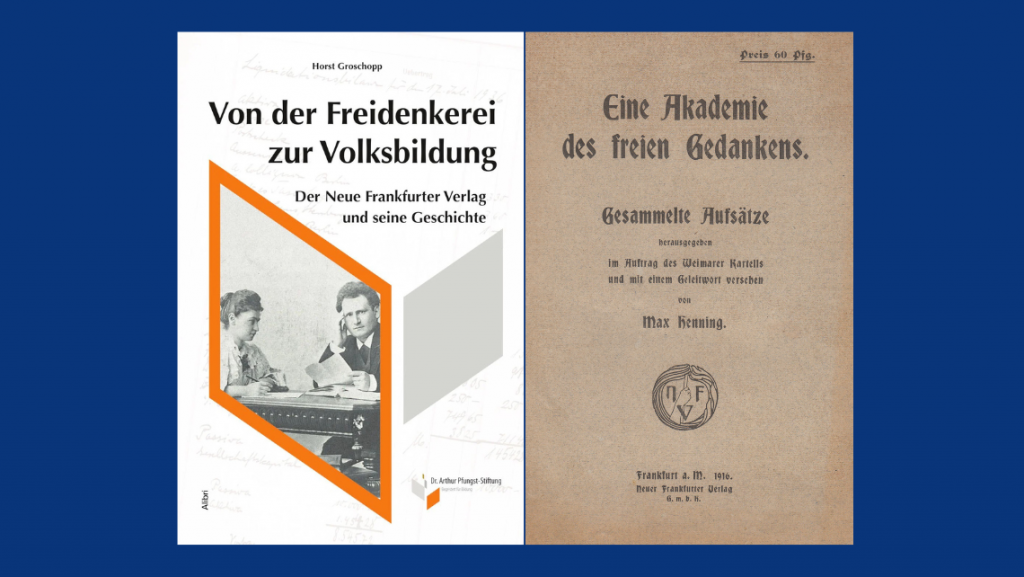


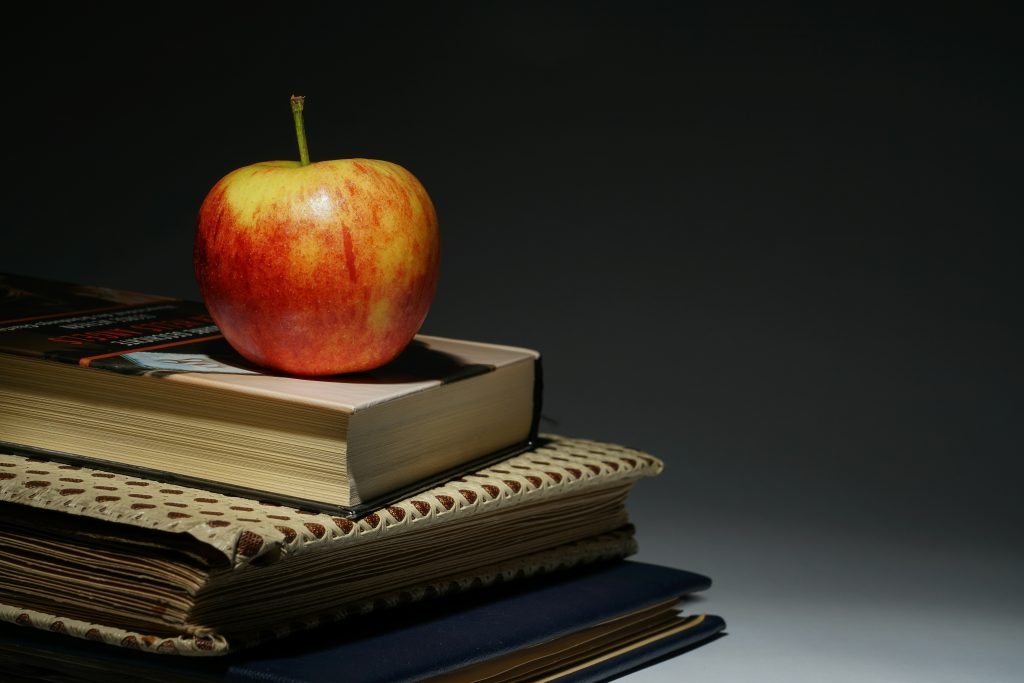

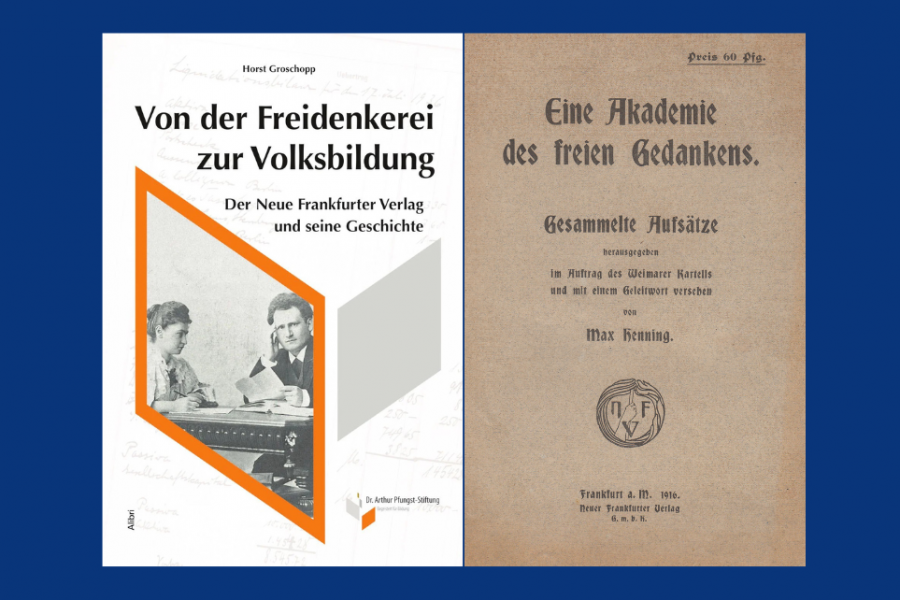
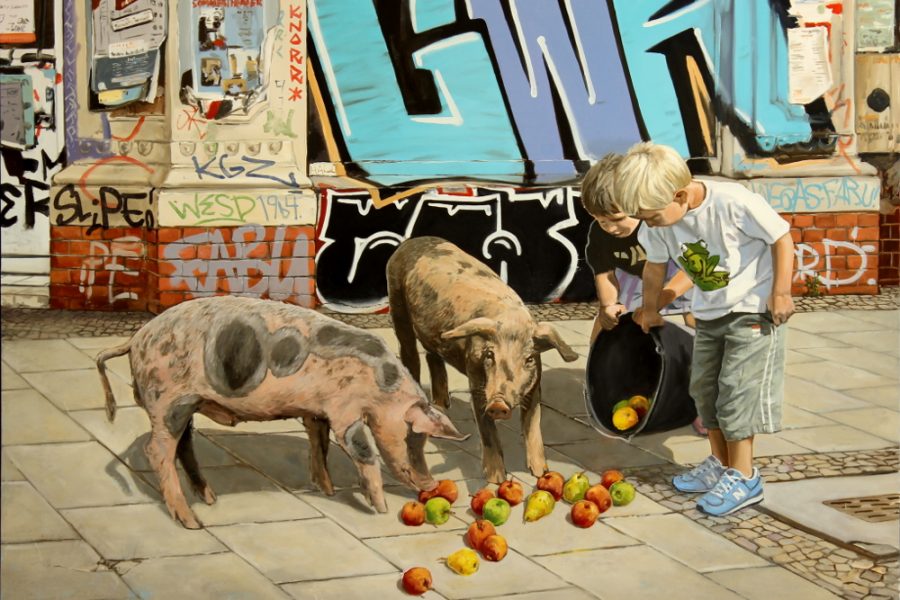

1 Gedanke zu „Ein Angriff auf das Verfassungsverständnis – und auf das liberale Fundament unserer Demokratie“
Genau So!
Dankeschön 🙏🏻 , sehr geehrte Katrin Raczynski, für Ihren sachlich einordnenden Kommentar.
Wie gelingt ‑heute- eine faire demokratische Auseinandersetzung? Wie können wir (jeder Einzelne/ich) diese stärken? Wie reagiert man auf Verletzungen oder Ansätze von Manipulationen, ohne „eigene“ mediale Plattform …?
Danke Ihnen sehr dafür! Jut: