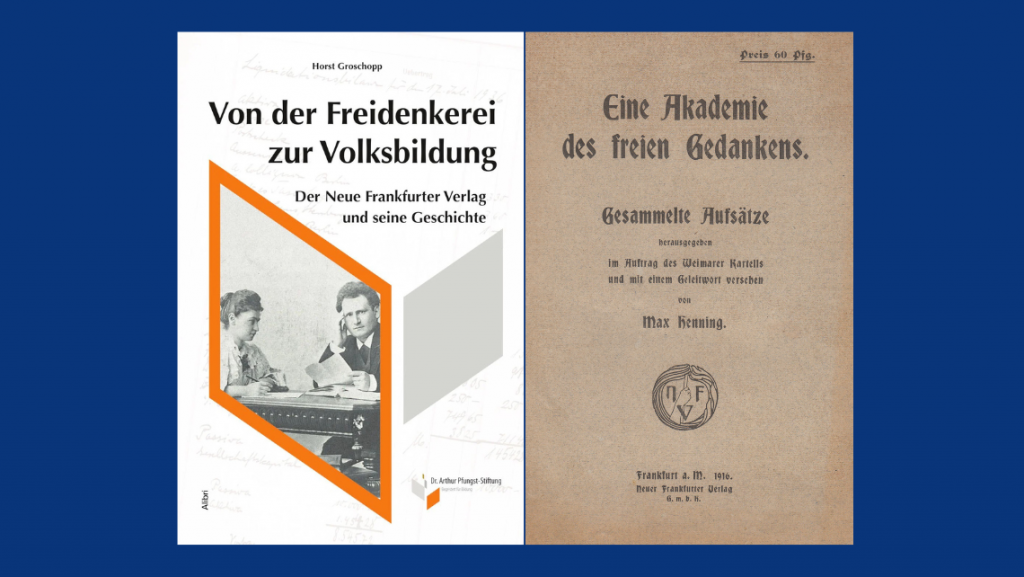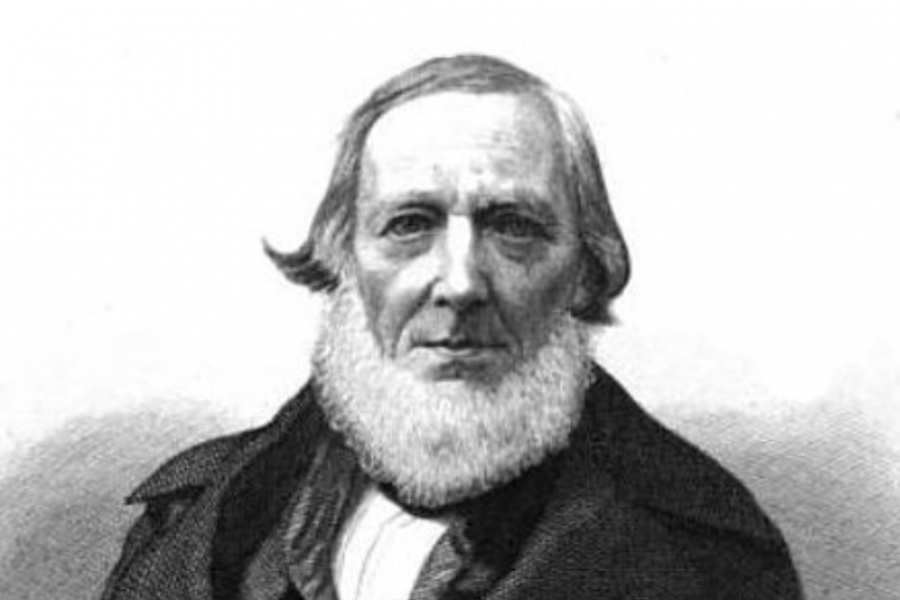Ein Krankenhaus, mitten in England. Der humanistische Seelsorger Bill begegnet auf seinem Weg über die Stationen einer Frau, die ihm mitteilt, dass ihr Krebs zurückgekehrt ist. Sie hat Tränen in den Augen, als sie ihm erzählt, wie erschöpft sie ist. Eine weitere Chemotherapie, da ist sie sich sicher, könnte sie nicht ertragen. Ihre Familie aber sei wie versteinert von der Aussicht, sie zu verlieren. Sie fürchtet: Wenn sie ihren Lieben ihren Wunsch mitteilt, dann werden diese sie anflehen, die Behandlung unbedingt fortzusetzen. Bill spricht behutsam mit ihr über ihren Wunsch und welche Kraft es sie kosten wird, ihrer Familie das zuzumuten. Doch am Ende ihres gemeinsamen Gesprächs scheint sie fest entschlossen, keiner weiteren Behandlung zuzustimmen. Sie bedankt sich bei Bill, dass er ihr beigestanden hat.
Was ein britischer humanistischer Seelsorger erlebte, könnte so oder so ähnlich überall passieren. Auf jedem Kontinent. Und nicht nur im Krankenhaus. Das Herzensanliegen: aus Menschenliebe einem Menschen in akuten Krisensituationen beistehen. Wenn völlig unklar ist, wie es weitergehen soll, da das Bekannte nicht mehr trägt. Wenn plötzlich alles infrage steht. In diesem Moment ein Gegenüber sein. Gemeinsam nach Sinn suchen. Verstehen wollen, liebevoll und geduldig. Menschliche Wärme geben, Mitgefühl und Respekt. Da sein.
In Verletzlichkeit Verbundenheit und Sinn erfahren
Schlicht dadurch geben weltliche Seelsorger*innen oft enormen Trost. Wenn sie aushalten, dass Tränen fließen und Verzweiflung sich Raum schafft. Wenn sie – sofern möglich und gewünscht – eine Umarmung geben. Wenn sie das Leben eines Menschen eine Zeit lang auf den eigenen Schultern mittragen. Wenn sie zur Ruhe, zum Atemholen, zum Erzählen und Philosophieren einladen – und dazu beitragen, sich inmitten größter Verletzlichkeit wertvoll und angenommen fühlen zu können. All das kann Sinn schaffen angesichts der Härten des Lebens. Ganz ohne religiöse Bezüge.
Dabei gründet humanistische Lebensbegleitung darauf, gelebtes Leben nicht zu beurteilen oder zu verurteilen. Seelsorger*innen erklären hilfesuchenden Menschen nicht deren Welt. Schon gar nicht sagen sie ihnen, wie sie ihre Probleme lösen sollen, sondern helfen ihnen, selbstbestimmt ihre eigenen Erklärungen und Lösungen zu finden – um so ein Stück des Weges mitzugehen und im besten Sinne des Wortes Lebensbegleiter*innen zu sein.
Humanistische Seelsorge: ein Zukunftsmodell
Davon braucht es viel mehr. Deshalb streben wir Humanist*innen nach Gleichbehandlung in einer hierzulande nach wie vor kirchlich dominierten Seelsorgelandschaft. Wir strecken die Fühler aus in öffentliche Bereiche institutioneller Lebensbegleitung. Humanist*innen werden auch in Gefängnissen, bei der Polizei, in der Notfallseelsorge und in anderen Bereichen des Lebens dringend gebraucht. In einer mit vielfachen Krisen belasteten Zeit wollen wir mit Fürsorge und Menschlichkeit an so vielen Orten wie möglich präsent sein, um humanistische Lebensbegleitung zu einem Zukunftsmodell unserer Zivilgesellschaft zu machen – einer Gesellschaft, in der Menschenliebe als Muttersprache des Humanismus erkannt wird.