Ende August hat das Bundeskabinett das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz beschlossen. Im Kern bleibt die Geschlechterungleichbehandlung jedoch bestehen: Männer sind verpflichtet, den neuen Fragebogen zur „Bereitschaft und Fähigkeit zum Wehrdienst“ auszufüllen, Frauen hingegen nicht. Sie können sich zwar freiwillig melden – und viele tun dies auch schon seit Jahren –, doch rechtlich bleibt ihnen die Pflicht erspart. Juristisch verweist das Verteidigungsministerium auf Artikel 12a Grundgesetz, in dem es heißt: „Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften […] verpflichtet werden.“ Politisch wirkt diese Sonderregelung wie ein Relikt aus den 1950er Jahren, gespeist aus einem konservativ-christlichen Frauenbild.
Und doch: Dass dieses Frauenbild historisch problematisch ist, macht das dahinterliegende Argument nicht automatisch falsch.
Feministische Paradoxien
Ich verfolge die Wehrpflicht-Debatte seit Wochen mit gemischten Gefühlen und versuche, meinem Unbehagen auf die Spur zu kommen. Einerseits bin ich überzeugt: Echte Gleichberechtigung bedeutet auch gleiche Pflichten. Feministische Bewegungen haben zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass es diskriminierend ist, wenn Frauen von bestimmten Bereichen ausgeschlossen werden – sei es beim Wahlrecht, im Arbeitsmarkt oder beim Zugang zu Führungspositionen. Warum sollte es also anders sein, wenn es um den Militärdienst geht? Ich verstehe mich selbst als Gleichheitsfeministin, woher also kommt die Skepsis, das Unbehagen bei entsprechenden Positionierungen, möchte doch auch ich nicht ein Frauenbild der 1950er Jahre verstetigt wissen? Die Skeptikerin in mir würde sich der Frage also vielleicht so annähern: Müssen wir ausgerechnet beim Militär damit beginnen, die Gleichstellung herzustellen, die in so vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen noch auf sich warten lässt? Muss der Preis für gleiche Rechte ausgerechnet darin bestehen, dass auch Frauen in den Krieg geschickt werden können?
Plötzlich überall Gleichheitsfeministen?
Beim Lesen der zahlreichen Meinungsbeiträge der letzten Wochen richtete sich mein Augenmerk sehr schnell auf die Sprecher*innen-Position, so eine Art Schnell-Check: spricht da jemand aus einer intellektuellen Komfortzone, vom Schreibtischstuhl aus? Kann sie*er überhaupt noch zum Dienst eingezogen werden? Oder wird hier aus sicherer Distanz gepflegt argumentiert? Auch bei einem gleichheitsfeministischen „Wenn, dann für alle“- Argument, wie zuletzt von Eva Ricarda Lautsch in der ZEIT, regt sich bei mir Unbehagen, ein leises Pick-me-Gefühl ereilt micht: Die Jungs alleine in den Krieg ziehen lassen? An jeder (anderen) Stelle auf Gleichberechtigung pochen, und wenn’s ernst wird kneifen? Vielleicht ist beides auch eine Argumentation von der „Hügelposition“ aus – so, wie Bertha von Suttner sie beschrieben hat: eine Perspektive der Distanz, in der die Brutalität des Krieges nicht unmittelbar vor Augen steht.
Problematisch an beiden Positionen ist für mich, dass Gleichstellung hier nur als formale Pflichtgleichheit verhandelt wird, ohne die aktuelle Gesamtsituation (von Ungleichkeit) kritisch in den Blick zu nehmen.
Noch irritierender wird es, wenn Politiker*innen, die zuvor nicht mit gleichheitsfeministischen Positionen aufgefallen sind, plötzlich so argumentieren und damit verschleiern, dass es primär um militärische Nützlichkeit und nicht um Gleichstellung geht. Dieses Muster ist altbekannt: Schon in meiner Diplomarbeit über Konstruktionen von Geschlecht in der Berliner Polizei (2001, gemeinsam mit Sonja Dudek) zeigte sich: Gleichstellung von Frauen wurde historisch an vielen Orten nicht aus Überzeugung vorangetrieben, sondern vor allem dann, wenn ein personeller Mangel herrschte. Geschlecht diente dabei als flexibles Argument: Mal wurde auf die „besondere Natur der Frau“ verwiesen, um ihre Eignung für bestimmte Aufgaben hervorzuheben, mal auf ihre „Andersartigkeit“, um sie wieder auszuschließen – je nachdem, was gerade opportun war. Dieses Muster ist heute in der Wehrpflichtdebatte erneut erkennbar: Es geht nicht (immer) um Gleichstellung um ihrer selbst willen, sondern um Nützlichkeit im Angesicht knapper Ressourcen. Das ist in Ordnung, aber es muss benannt und voneinander unterschieden werden. Und Gleichheitsfeministinnen werden zu Steigbügelhalterinnen, wenn sie diesem Argument allzu bereitwillig folgen.
Männlichkeit und Gewalt – eine unauflösbare Verbindung?
Gewalt ist in unserer unvollkommenen Welt überwiegend männlich. Das belegen zahllose Statistiken – ob bei Tötungsdelikten, Körperverletzung oder sexualisierter Gewalt. Laut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sind weltweit über 90 Prozent der Täter bei vorsätzlichen Tötungsdelikten Männer. In Deutschland waren 2023 über 95 Prozent der Tatverdächtigen bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung männlich. Diese Formen unrechtmäßiger Gewalt dürfen natürlich nicht gleichgesetzt werden mit der Frage nach legitimer Landesverteidigung. Und doch zeigt uns die Menschheitsgeschichte, wie sehr Macht und Männlichkeit historisch mit Gewalt verwoben sind.
Auch vor diesem Hintergrund wirkt es zynisch, Frauen durch eine Ausweitung der Wehrpflicht gleichstellen zu wollen. Dass die Bundeswehr als „männliches System“ funktioniert, hat ein Beitrag der ZEIT eindrücklich beschrieben: „Angefasst, angepinkelt, ausgepeitscht – willkommen bei der Bundeswehr.“ Dort heißt es: „Übergriffe, Demütigungen und Rituale der Unterwerfung gehören für viele Soldaten noch immer zum Alltag.“ Solche Berichte lassen erahnen, was es heißen kann, wenn Frauen in eine Domäne eintreten, die, zumindest teilweise, immer noch von Männlichkeitsritualen, Hierarchien und Grenzverletzungen geprägt ist.
Wider der Unkenrufe
Ich höre schon die Unkenrufe und Missverständnisse, die sich aus einer solchen Position ergeben könnten und möchte diesen gleich vorbeugen: Frauen möchte ich hier nicht automatisch als friedfertige Wesen beschreiben, die von „Natur aus“ versöhnen oder Gewalt verhindern. Es geht nicht darum, Frauen zu heroisieren. Aber es geht darum, sie davor zu schützen, aus Gründen blanker Nützlichkeit, garniert mit gleichheitsfeministischem Anstrich, in die militärische Pflicht zu nehmen.
Vielleicht müssen wir den Gedanken, was Emanzipation und Gleichstellung in diesem Kontext heißen kann, neu denken. Schon die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner schrieb in Die Waffen nieder!: „Nach meiner Überzeugung wird das Schwerterhandwerk aufhören müssen, wenn die Frauen in der Gesellschaft die Bedeutung erlangen, die ihnen zukommt.“
Das emanzipatorische Potenzial liegt womöglich nicht darin, Frauen an der Waffe gleichzustellen, sondern die enge Verbindung von Männlichkeit und Gewalt zu überwinden – und dadurch neue Formen von Sicherheit und Frieden möglich zu machen.[1] Ebenso bedeutend ist es, soziale Sicherheit, Care-Arbeit und Bildung als Grundpfeiler von Friedenspolitik zu fördern – weil Gesellschaften mit gerechteren Teilhabechancen weniger anfällig für Militarisierung und Radikalisierung sind.
Gleichberechtigung beginnt nicht an der Waffe
Wir müssen überall auf der Welt miterleben, dass es Situationen gibt, in denen Verteidigung mit Waffengewalt unvermeidbar ist. Wer Gleichberechtigung ernst nimmt, sollte sie aber nicht zuerst an der Waffe einfordern, sondern dort, wo es um Frieden, Sicherheit und politische oder zivilgesellschaftliche Verantwortung geht.
Und vielleicht ist es manchmal klüger, mit dieser – aus der Perspektive eines Gleichheitsfeminismus – ‘inkonsequenten’ Haltung zu leben, als zum falschen Zeitpunkt in einer zweifelhaften Konsequenz zu enden.
[1] Für die Ausführung und Konkretisierung dieser Forderung gibt es zahlreiche Ansätze (Ziviler Friedensdienst Deutschland, Frauenbewegungen in Kriegsgebieten in Ruanda und Liberia, UN-Resolution 1325, die die Bedeutung der Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen anerkennt u.a.m.) , deren Vertiefung diesen Beitrag hier überfordern würde.



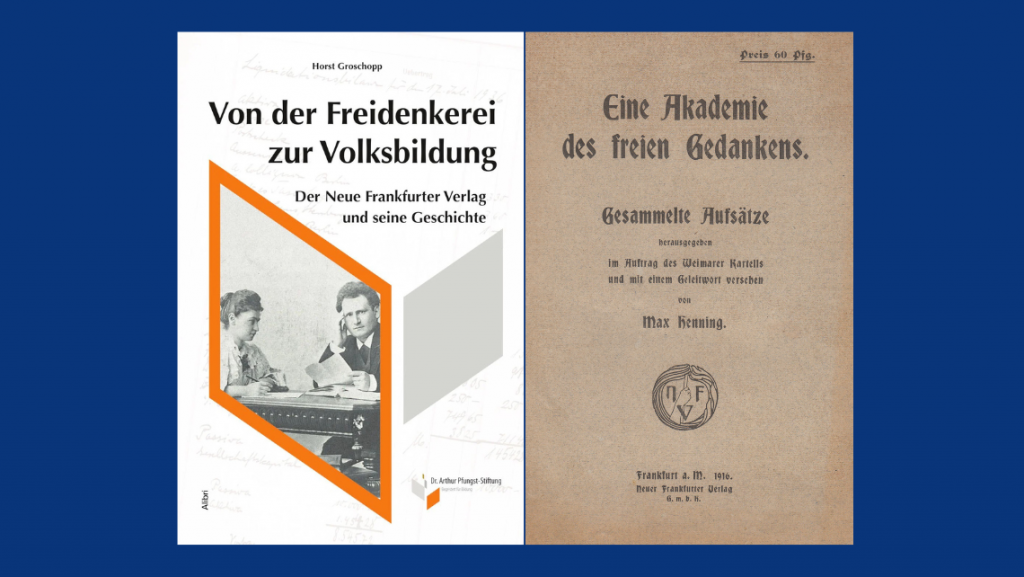


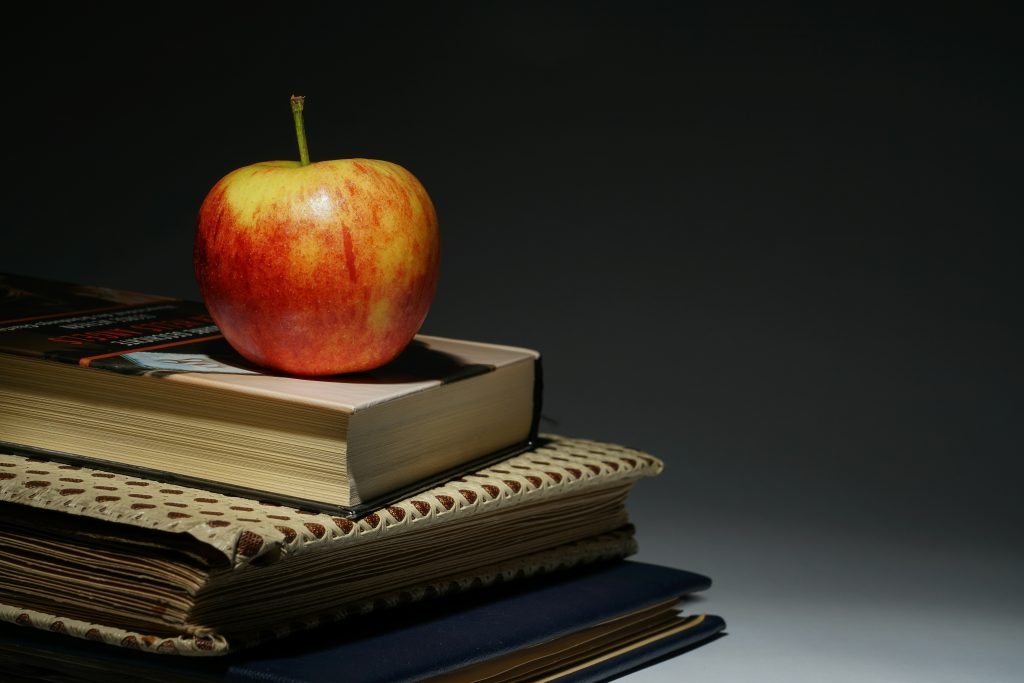
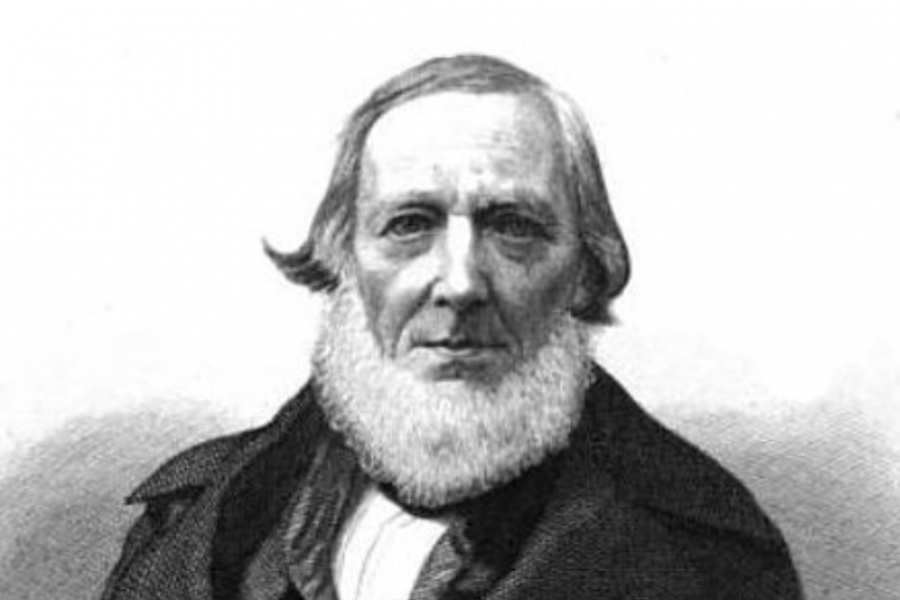
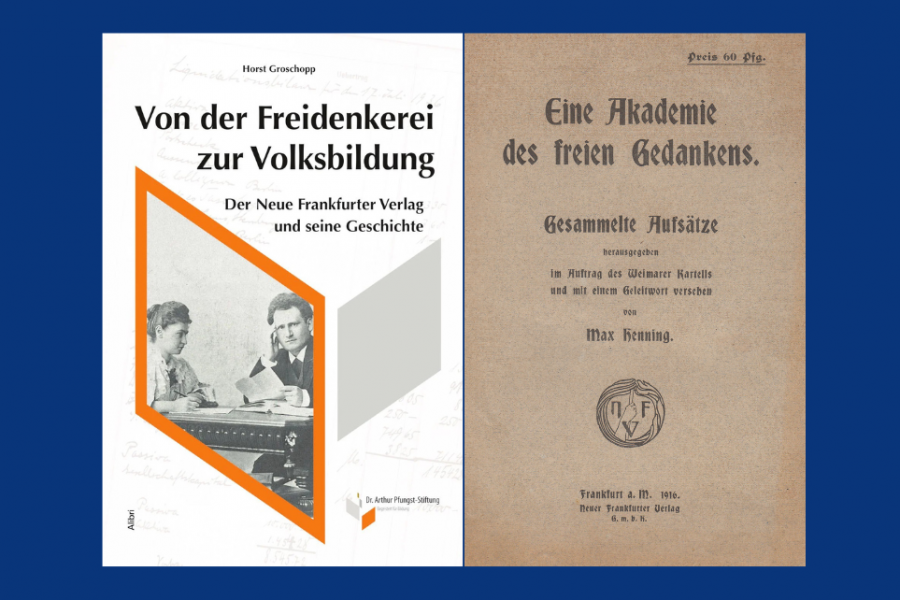
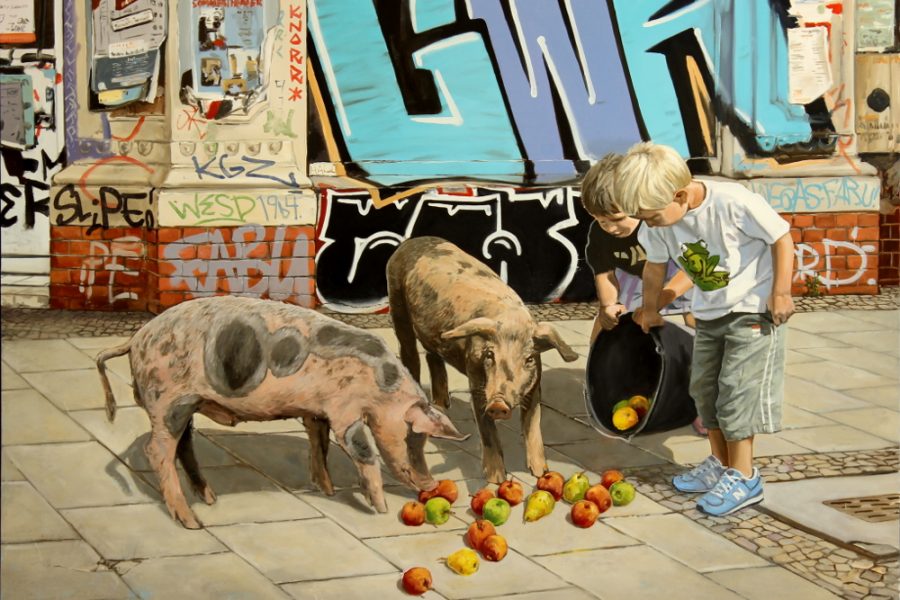
2 Gedanken zu „Gleiche Rechte, gleiche Pflichten? Warum die Wehrpflicht kein feministisches Projekt ist“
Ich habe den Kriegsdienst an der Waffe verweigert und bewusst 18 Monate Zivildienst in Kauf genommen – drei Monate mehr, als der Kriegsdienst dauerte. Gleichberechtigung bedeutet für mich nicht „gleiche Pflichten um jeden Preis“, sondern gleiche Entscheidungsfreiheit. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, soll das freiwillig tun – ob in Pflege, Rettung oder auch in der Bundeswehr. Einen verpflichtenden Dienst an der Waffe lehne ich daher für alle Geschlechter ab.
Grundsätzlich leben wir in einem Zeitalter der Gleichberechtigung für alle.
Als Mann dürfte dementsprechend natürlich argumentiert werden, warum soll ich, weil ich ein Mann bin und Frauen sind außen vor, dass ist ja dann keine Gleichberechtigung mehr.
Das eine emanzipierte Frau gerne mehr Gleichberechtigung in Sachen Lebenskomfort anstrebt als den Dienst an der Waffe, überrascht natürlich kein bisschen. Aber auch die unschönen Seiten der Gleichberechtigung gehören dann nunmal für alle dazu.