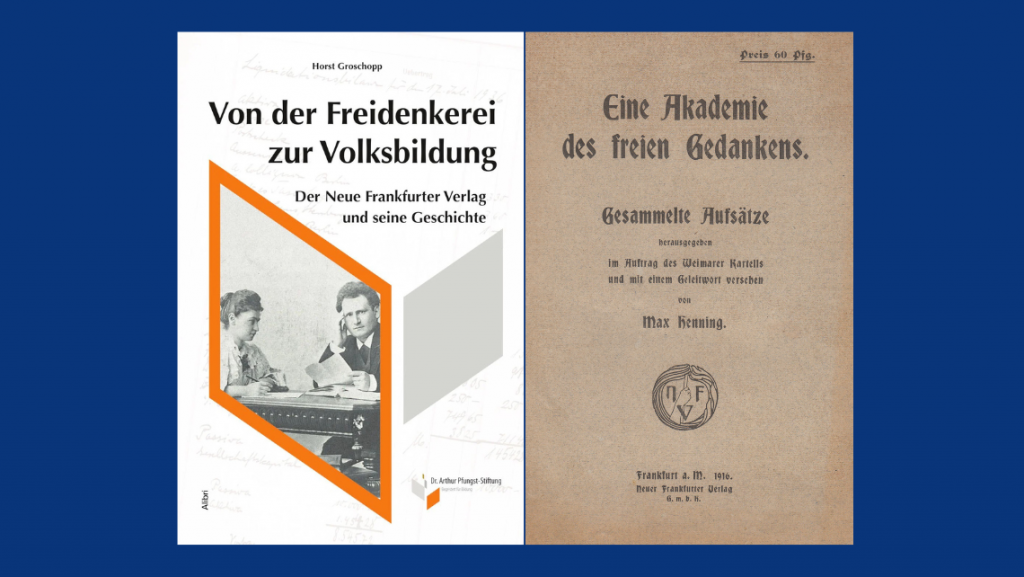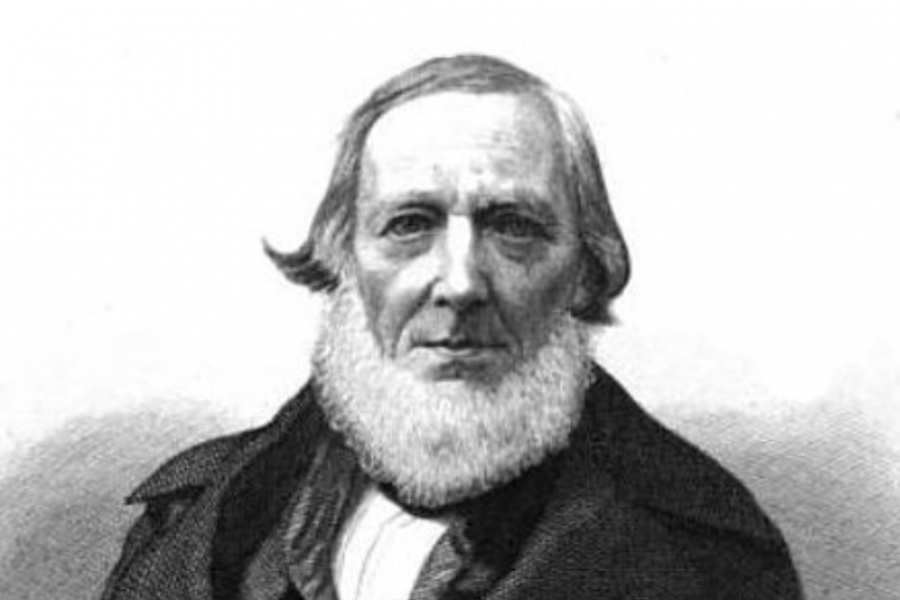Humanismus ist ein weites Feld. Heute möchte ich einen Autor vorstellen, der trotz der komplexen Weltprobleme explizit Mut machen will auch in Zeiten, in denen sich Defätismus breitmacht, für viele Menschen der Zukunftshorizont eintrübt und ihnen konkrete Ideen, ja selbst die Träume von gerechteren und humaneren Lebensverhältnissen abhandenkommen.
Der britische Wirtschaftsjournalist Paul Mason (Jahrgang 1960) will sich den Glauben an eine „klare, lichte Zukunft“ der Menschheit von Trump & Co und den Ängsten vor einem reaktionären digitalen Überwachungsstaat nicht zerstören lassen. Die größten Bedrohungen für den Menschen als autonomes, gemeinschaftliches Wesen sieht er in der neoliberalen Ideologie der freien Marktwirtschaft, die seit Thatcher und Reagan die Politik beiseite gedrängt hat und seit ihrem Zusammenbruch in einen national-autoritären Kapitalismus transformiert wurde, der die Reichen schützt und Freiheitsrechte aushebelt, und zweitens in digitaler Kontrolle, falsch programmierter KI und einer neuen „Maschinengläubigkeit“. Aktuell sieht er die Gefahr, dass „die Unterwerfung unter die Logik des Marktes den Weg zur Unterwerfung unter die Logik der Maschine ebnet“. Obwohl das Buch schon 2019 erschienen ist, „passen“ leider sowohl der Ukrainekrieg als auch Trump II zu seinen längerfristigen Analysen.
Lösungsperspektiven sieht er in einem befreienden „radikalen Humanismus“, der an die Grundgedanken des frühen Karl Marx zur Natur des Menschen in der realen Welt und zu seinem Emanzipationspotential anknüpft, der aus Fehleinschätzungen von Marx lernt und der die Fehler und Verbrechen des Staatssozialismus nicht verharmlost. Auf jeden Fall müsse heute die ökologische, die frauenemanzipatorische und die postkoloniale Perspektive einbezogen werden. An den universalistischen Menschenrechten, dem freien Willen und der Idee der Selbstbefreiung des Menschen sei unbedingt festzuhalten! Wir sind nicht nur Algorithmen! Der Humanismus der 50er Jahre, etwa von Arendt, Levi und Orwell, reiche heute nicht mehr, um die „Religionen des Irrationalismus und Fatalismus zu entzaubern.“ Träger des Widerstands und Vorkämpfer der notwendigen Weichenstellung sei heute nicht mehr die Arbeiterklasse, sondern das vernetzte Individuum, das sich in Konsumstreikbündnissen, Genossenschaften, Kampagnen und auch in progressiven Parteien organisieren müsse. Wichtig sei die Wiederherstellung einer „kollektiven plebejischen Moral“. Es gelte, „Löcher in das Fundament der kapitalistischen Herrschaft zu schlagen“ und „Räume zu schaffen, in denen wir unseren Traum von der Menschlichkeit ausleben können“.
Detailreich und sehr lesenswert analysiert Mason zu Beginn den Aufstieg Trumps und führt ihn letztlich auf die fehlgeleitete Wirtschaftspolitik des globalen Neoliberalismus und dessen Transformation nach der Finanzkrise 2008 zurück. Autobiographisch berichtet er von seiner Kindheit in den 1960ern, als es den Arbeitern in England noch gut ging. Die „Religion“ des Marktes habe dann seit den späten 1970ern die Einheit der Arbeiterklasse zerstört, viele Verlierer produziert und ihnen auch noch eingeredet, dass sie an ihrem Abstieg selbst schuld wären. Kapitalistisches Konkurrenzdenken und die „Sorge um sich allein“ sei in alle Bereiche der Gesellschaft eingezogen, habe das solidarische Selbst deformiert und verängstigte, mutlose Individuen zurückgelassen. Hier ist Mason im Einklang mit vielen anderen KritikerInnen.
Spannend zu lesen ist dann die Analyse der Finanzkrisen in den 2000er Jahren und der weiteren staatlichen Wirtschaftspolitik im Westen. Mason deutet sie kenntnisreich als eine Selbstzerstörung des Neoliberalismus, der sich vom Staat helfen lassen musste und ihn danach in der Variante „national-autoritärer Liberalismus“ gekapert hat.
Kritisch rekonstruiert er das Verhältnis von Mensch und Maschine. Der Bergmannssohn ist keineswegs technologiescheu und will die Chancen der Automatisierung und Digitalisierung nutzen: Die Maschinen sollen für die Menschen arbeiten, sie aber nicht nachahmen und kontrollieren. Deshalb muss in die KI ein ethischer Kodex einprogrammiert werden.
Religionskritik kommt bei Mason nur am Rande vor. Die gegenaufklärerischen „Offensiven gegen den Humanismus“ wie der Transhumanismus, der Posthumanismus, das angebliche „Ende der Geschichte“ 1989 und die kulturelle Postmoderne insgesamt stehen für ihn in einem direkten Zusammenhang mit dem ökonomischen Neoliberalismus. Sie werden aber nicht in einen Bezug zu einer „Rückkehr der Religion“ gesetzt. Historisch billigt er den Weltreligionen humanistisches Potential zu; die subversive Verdrängung der maroden römischen Staatsreligion durch das Christentum in der Spätantike sieht er sogar als beispielgebend für ein erfolgreiches Agieren des radikalen Humanismus „von unten“ in der Gegenwart.
Lassen wir Mason selbst zu Wort kommen: „Ich bin ein radikaler Humanist, der glaubt, dass wir kurz davor stehen, etwas zu verwirklichen, das Marx vorschwebte: Eine von der Technologie befähigte Gesellschaft, in der die meisten Dinge, die wir konsumieren, kostenlos sein werden, und eine massenhafte Veränderung des menschlichen Wesens, die es uns erlauben wird, die neue Freiheit zu nutzen. Wie Marx glaube ich, dass unser Streben nach Freiheit das Produkt unserer Evolution ist und dass die jüngsten Fortschritte in Genetik, Evolutionsbiologie und Neurowissenschaft diese Überzeugung bestätigen. Wie Marx glaube ich, dass eine auf dem Privateigentum beruhende Gesellschaft die Vergesellschaftung des Wissens durch den technologischen Fortschritt nicht überstehen wird. Aber anders als Marx glaube ich, dass diese Revolution der Menschheit nicht durch das unbewusste Handeln einer einzelnen Klasse, sondern durch ein vielgestaltiges Netzwerk bewusst handelnder menschlicher Wesen herbeigeführt wird. Anders als Marx glaube ich, dass der Planet dem Einsatz der Technologie Grenzen setzt und uns zwingt, bei der Überwindung des Kapitalismus bestimmte Prioritäten zu setzen. Und anders als Marx breche ich nicht in Gelächter aus, wenn ich das Wort „Moralphilosophie“ höre, denn um die Technologie beherrschen zu können, die wir nutzen werden, um den Überfluss zu erreichen, brauchen wir einen globalen ethischen Rahmen.“ (S. 304)

Paul Mason: Klare, lichte Zukunft. Eine radikale Verteidigung des Humanismus.
Suhrkamp, Berlin, 2019
415 Seiten, 32 €
ISBN: 978–3‑518–42860‑3
Der Beitrag erschien zuerst in Freies Denken 2 | 2025. Wir danken dem Humanistischen Verband Nordrhein-Westfalen für die freundliche Genehmigung zur Zweitveröffentlichung.