Frau Matthies, wie kann ich mir die Arbeit und den Alltag in einem Hospiz vorstellen?
Matthies: Einen „normalen“ Tagesablauf gibt es im Erwachsenenhospiz nicht in dem Sinne. Man darf sich das nicht vorstellen wie im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Die Menschen, die zu uns kommen, bestimmen ihren Tagesablauf selbstständig, so gut und so lange es geht. Menschen gehen ja in ein Hospiz, um zu sterben – oder, um die letzten Tage zu leben. Wir sind dabei nur die Unterstützer. Die Gäste, die zu uns kommen, sind relativ aufgeräumt und wissen, wo die Reise hingeht. Aber für die Angehörigen ist es oft etwas anderes. Es ist also auch unsere Aufgabe, sie zu unterstützen, sie aufzufangen und es für sie irgendwie erträglicher zu machen.
 Bild: Hoffotografen
Bild: HoffotografenFranziska Matthies (*1971) arbeitete viele Jahre als Krankenschwester im Intensivbereich, seit 2009 ist sie in der Hospizarbeit tätig und absolvierte daneben ein Studium zur Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen. Ab 2015 Pflegedienstleitung beim HVD Berlin-Brandenburg, seit 2021 stellvertretende Leitung der Abteilung Humanistische Hospize.
Was können Sie denn tun, um die Angehörigen zu unterstützen?
Matthies: Wir haben als einziges Hospiz in Berlin eine Psychoonkologin, das ist, wie ich finde, eine ganz wichtige Maßnahme für die Angehörigen. Oft sind es auch einfach Kleinigkeiten, die wir tun können: mit am Bett sitzen, mit den Angehörigen sprechen. Unsere Wohnküche ist ein sehr guter Ort, um ins Gespräch zu kommen. Und oft sind die Angehörigen erleichtert, wenn sie mitbekommen: In diesem Haus wird ja auch gelacht. Man muss einfach offen, ehrlich und zugewandt sein.

LudwigPark
Das Hospiz LudwigPark besteht seit 2009 und ist ein stationäres Erwachsenenhospiz. Es bietet palliativmedizinische, pflegerische und psychosoziale Versorgung und Begleitung für schwerkranke Menschen sowie Sterbe- und Trauerbegleitung für Betroffene und ihre Angehörigen an.
Frau Sebayang, wie unterscheidet sich die Arbeit im Kinderhospiz vom Erwachsenenhospiz?
Sebayang: Der große Unterschied ist, dass Kinderhospize nicht erst am Ende des Lebens zuständig werden, sondern ab Diagnosestellung einer lebensverkürzenden Erkrankung. Die Lebenserwartung ist hier aber nicht begrenzt auf Tage, Wochen oder Monate, sondern kann auch auf Jahre begrenzt sein. Wir begleiten die Familien ab Diagnosestellung – und auch über den Tod des erkrankten Kindes hinaus.
Und wie sieht diese Begleitung aus?
Sebayang: In der Kinderhospizarbeit begleiten wir immer die gesamte Familie. Gerade stationäre Kinderhospize sind dafür da, den Familien Entlastung anzubieten. Sie können also auch mehrmals im Jahr kommen und die Angebote nutzen, um dann gestärkt nach Hause zu gehen und wieder den Alltag zu bestreiten. Zum Alltag gehören eben auch immer wieder Krankheitskrisen, Notfälle, Krankenhauseinweisungen. Es geht auch viel um Krankheitsverarbeitung: Eltern müssen verarbeiten, dass ihr Kind vor ihnen sterben wird, dass ihr Kind zunehmend krank und bedürftig wird. Und daneben gibt es natürlich auch die Geschwister, die das auch alles erleben müssen. Die kriegen in der Kinderhospizarbeit einen großen Fokus, denn das sind die, die überleben, die bleiben müssen und die gesund in die Welt gehen sollen. Daher gibt es viel Präventionsarbeit, psychosoziale Angebote und sehr viel Anleitung zur Selbsthilfe. Es geht also um eine Begleitung dieses Prozesses und auch viel um Entscheidungsfindung – da kommt man natürlich auch zu ethischen Fragestellungen.
Können Sie dazu ein Beispiel geben?
Sebayang: Das Kind verschluckt sich, weil es keine Zungenmotorik mehr hat – legen wir dann einen Schlauch in den Bauch oder lassen wir es sein? Die Lunge arbeitet nicht mehr richtig – schließen wir eine Beatmungsmaschine an oder lassen wir es sein? So etwas entscheidet man natürlich nicht in einer Viertelstunde, sondern über Wochen, Monate und Jahre immer wieder im Gespräch. Eltern wollen in der Regel alles tun, ihr Kind bei sich zu behalten. Es wird irgendwann schwierig, wenn es darum geht, das Kind gehen zu lassen. Man muss also immer wieder hinschauen und fragen: Sind diese Maßnahmen jetzt noch gut fürs Kind? Das ist ein Prozess, denn am Ende müssen die Eltern mit ihrer Entscheidung leben.
Wie gehen Sie in der Kinderhospizarbeit mit dem Thema Tod um?
Sebayang: Das Thema Tod ist immer dabei. Manchmal kommt es ganz plötzlich, weil von einem Kind ein toter Marienkäfer draußen im Garten gefunden wird. Dann wird innegehalten oder darüber geredet – und dann geht das Leben weiter. Im Grunde ist die Hospizarbeit ganz viel Normalität. Das Leben steht mehr im Vordergrund als der Tod. Hier liegt aber noch ein weiterer großer Unterschied zur Erwachsenenhospizarbeit: Wir machen sehr viel länger Trauerbegleitung. Manche Familien nutzen die Angebote über viele Jahre.
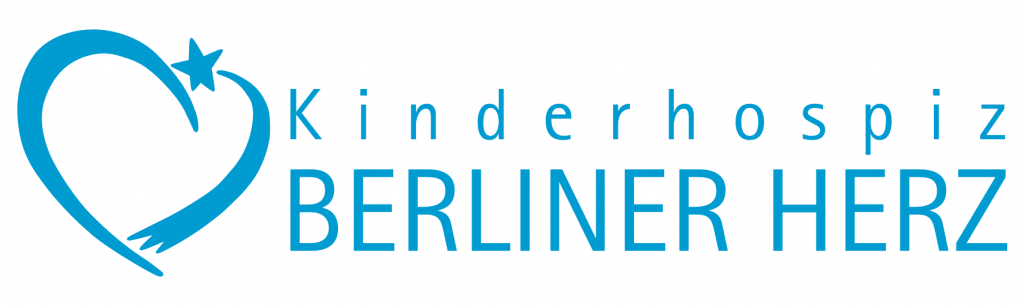
Berliner Herz
Das Kinderhospiz Berliner Herz ist das bundesweit erste seiner Art, das sowohl die vollstationäre als auch die teilstationäre Aufnahme für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsenen im Alter von 0 bis 27 Jahren und ihre Familien ermöglicht.
Im Kinderhospiz geht es also um Lebensbegleitung, um die Aufrechterhaltung von Lebensqualität. In ein Erwachsenenhospiz kommt ein Mensch aber zum Sterben. Wie werden dort Entscheidungen über medizinische Maßnahmen getroffen, Frau Matthies?
Matthies: Selbstbestimmung spielt eine große Rolle. Wenn ein Gast zum Beispiel nichts mehr essen will, dann ist das eben so. Wir werden trotzdem Nahrung anbieten, aber natürlich niemanden zwingen. Wenn der Gast länger bei uns war und wir ihn und seine Wünsche gut kennen, dann können wir das ganz gut einschätzen. Es gibt aber auch Gäste, die in einem so schlechten Zustand zu uns kommen, dass das Sterben nur eine Sache von wenigen Tagen oder sogar Stunden ist. Und die kennen wir dann natürlich nicht, da brauchen wir die Angehörigen. Manchmal gibt es aber auch die nicht. Dann versuchen wir, bei unseren Entscheidungen, gerade in der präfinalen Phase, von uns und unseren Erfahrungen auszugehen: Was würden wir jetzt gut finden? Das ist Erfahrung und ganz viel Empathie. Die Menschen kommen ja, um diesen Weg zu gehen. Sie vertrauen uns, das muss man sich bewusst machen. Es gibt natürlich auch Fallbesprechungen, in denen man sich im Team austauscht: Was kann man dem Gast Gutes tun? Und in bestimmten Fällen spricht man mit der Ärztin. Wir können aber nur beratend tätig werden, wir sind die Vermittler zwischen Patient und Arzt.
Ich kann mir denken, dass jeder Mensch, der in einem Hospiz arbeitet, seine Strategien im Umgang mit dem Sterben gefunden hat. Trotzdem ist es sicherlich nicht leicht, wenn ein Gast stirbt, oder?
Matthies: Im Team wird sich viel ausgetauscht, darüber stärkt man sich gegenseitig. Aber der Tod ist niemals Routine, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Jeder Tod ist anders, jeder Sterbende ist anders – und jeder geht auch anders damit um. Aber wenn die Menschen zu uns ins Hospiz kommen, wissen sie es und wir wissen es auch: Die Medizin hat hier ihre Grenzen, der Weg ist unumkehrbar. Wir begleiten sie dann auf diesem Weg, ermöglichen es, diese letzte Zeit zu nutzen – und das ist ja etwas sehr Schönes, eine wunderschöne Arbeit. Man muss natürlich eine gesunde Einstellung zum Leben und zum Tod haben.
 Bild: Hoffotografen
Bild: HoffotografenSabine Sebayang (*1965) arbeitete zunächst als Kinderkrankenschwester in der Kinderonkologie, seit 20 Jahren ist sie im Kinderhospiz- und Palliativbereich tätig. Seit 2018 ist sie beim HVD Berlin-Brandenburg tätig, zunächst Bereichsleitung für die Hospizangebote, seit 2021 Leitung der Abteilung Humanistische Hospize.
Kann man sich diese Einstellung erarbeiten?
Sebayang: Ich denke schon, dass man manche Dinge lernen kann. Diese Grundhaltung, von der Franziska sprach, das Menschliche und die Empathie, das sollte gegeben sein. Aber der Umgang mit Leben und Tod kann sich auch entwickeln. Ich habe ja als Lebensretterin angefangen und dann gemerkt: Wir können nicht jedes Kind heilen. Als ich jünger war, war ich bei jedem Kind, das gestorben ist, wirklich verzweifelt und habe sogar überlegt, ob ich den Beruf wechseln soll und Erzieherin werde. Bei mir war das ein Prozess hin zur Lebensbegleiterin. Ich akzeptiere, dass nicht jeder Mensch geheilt werden kann. Aber ich kann dieses Leben begleiten und so vieles tun, das ist etwas sehr Schönes.
Haben Sie beide vielen Dank für das Interview!
Hospize sind auf Spenden angewiesen
Unterstützen Sie die Arbeit der humanistischen Hospize mit Ihrer Spende!
Spendenkonto LudwigPark: Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE39100205000003136435
Spendenkonto Kinderhospiz Berliner Herz: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE43100205000003136460, BIC: BFSWDE33BER, Betreff: stationäres Kinderhospiz Berliner Herz









