Herr Professor Gansel, sprechen wir darüber, was Literatur ist, was sie kann und was sie vielleicht sogar soll. Hat Literatur eine gesellschaftliche Aufgabe?
Mit Kunst und Literatur schaffen moderne Gesellschaften sich Formen der Selbstbeobachtung. Literarische Texte praktizieren mithin das „Sichtbarmachen des Unsichtbaren“, wie der große Soziologe Niklas Luhmann das gesagt hat. Kunst insgesamt habe daher die Aufgabe, die jedem geläufige Realität „mit einer anderen Version derselben Realität“ zu konfrontieren. Von daher hat Literatur eben auch dort hinzugehen, wo es weh tut. Insofern ist Literatur durch keine andere Form der Wirklichkeitsaneignung zu ersetzen. Dabei ist die Autonomie der Kunst Grundlage dafür, dass Literatur mit ihren Geschichten eine kritische Reflexion der Gesellschaft betreiben kann. Alle Versuche, die Kunstfreiheit einzugrenzen, führen zu einer Reduzierung dieser Aufgabe.
Was bedeutet es, wenn diese Idee einer autonomen Kunst nicht mehr von allen geteilt wird?
Es gibt Tendenzen, die formulieren, dass Autonomie und Kunstfreiheit möglicherweise überholt seien. Würde eine solche Auffassung sich durchsetzen, dann würde die kritische Selbstbeobachtung in Frage gestellt. Es bestände die Gefahr, Kunst auf Affirmation zu reduzieren. Bei den erzählten Geschichten würde peinlich genau darauf geachtet, dass die jeweils gültigen Normen und Werte nicht verletzt würden. Wenn – von wem auch immer – versucht wird, die Kunstfreiheit zu beschneiden oder Autorinnen und Autoren dafür zu rügen, dass sie kritisch die Gesellschaft reflektieren oder Geschichten erzählen, die sich quer zu dem befinden, was die gerade existierende politisch-kulturelle Auffassung war oder ist, dann sind wir auf einem sehr problematischen Weg.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Denken wir an die Debatten um Günter Grass‘ „Ein weites Feld“ von 1995. In dem Roman findet sich eine kritische Darstellung des Wiedervereinigungsprozesses nach 1989, die als eine Art Kolonialisierung durch den Westen erzählt wird. Die Hauptfigur Fonty spricht von der DDR als einer „kommoden Diktatur“. Die vermeintlich nicht hinreichende Verurteilung der DDR wie einzelne Positionen der Figuren waren die Grundlage für Abwehr und Verriss. Allerdings hat ein Roman keine Bestätigung gängiger politischer Auffassungen zu liefern, und die Positionen seiner literarischer Figuren sind schon gar nicht mit dem Autor gleichzusetzen. Vergleichbares geschah mit Christa Wolfs „Stadt der Engel“, aktuell betrifft dies Uwe Tellkamp und seinen Roman „Der Schlaf in den Uhren“.
 Bild: Konstantin Börner
Bild: Konstantin BörnerProf. Dr. Carsten Gansel (*1955) ist Professor für Neuere deutsche Literatur und Germanistische Literatur- und Mediendidaktik an der Universität Gießen. Er ist Vorsitzender der Jury zur Verleihung des Uwe-Johnson-Literaturpreises sowie des Uwe-Johnson-Förderpreises.
Uwe Johnson hat einmal gesagt: „Das Erzählen fängt an, wenn die Geschichte zu Ende ist.“ Agiert Literatur also vor allem retrospektiv? Was kann uns Literatur zu den gegenwärtigen Krisen sagen?
In der Tat. Man braucht einen gewissen Abstand, um eine Geschichte zu erzählen. Noch dazu, wenn es um historische Ereignisse geht. Nehmen wir die Forderung nach dem Wenderoman, der den Herbst 1989 ins Zentrum stellen sollte. Es hat lange gedauert, bis Texte erschienen sind, in denen man diese Hoffnung erfüllt sah. Erst 2008 erschien Uwe Tellkamps „Der Turm“, also um die 20 Jahre später, und 2014 Lutz Seilers „Kruso“. Übrigens zwei Roman, die vor der Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis den Uwe-Johnson-Preis erhielten. Weil Literatur eben kein bloßes „Abbild“ und keine simple „Widerspiegelung“ von Gegenwärtigem ist, braucht es Zeit, bis die Geschichte(n) erzählt werden. Weil das so ist, äußern sich viele Autorinnen und Autoren essayistisch oder mit poetologischen Statements. Das kann zum Problem werden, weil sie dann in eine andere Handlungsrolle wechseln, mitunter in jene von politischen Handlungsträgern. Autorinnen und Autoren sind keine Pressesprecher einer Frau Merkel oder eines Herrn Scholz – da sind wir wieder bei der kritischen Reflexion und Selbstbeobachtung von Gesellschaft –, sondern genau das Gegenteil.
Wie stehen Literatur und Erinnerung zueinander?
In Gesellschaften stehen verschiedene Gruppen- und Kollektivgedächtnisse miteinander in Konkurrenz, von daher existiert eine Art Streit um die Deutungshoheit von Erinnerungen. Insofern ist der „Kampf“ um die Erinnerung ein „Kampf“ um die jeweilige Bewertung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In diesem Aushandlungsprozess erlangen spezifische Erinnerungskonzepte letztlich Hegemonie, kulturelle Majorität und Macht. Andere werden als minoritär eingestuft und an den Rand gedrängt. Erfahrungen und Erinnerungen, die im dominanten Kollektivgedächtnis ausgeschlossen oder verdrängt werden, können nun gerade in der Literatur Gegenstand von alternativen Vergangenheitsversionen sein und auf diese Weise eine Art Gegengedächtnis etablieren. In pluralen Gesellschaften, die über eine funktionierende Öffentlichkeit verfügen, besteht somit die Chance, das hegemoniale Kollektivgedächtnis sukzessive durch minoritäre Konzepte zu erweitern. Von daher darf Literatur sich nicht korrumpieren lassen von den jeweiligen Mehrheitsmeinungen.
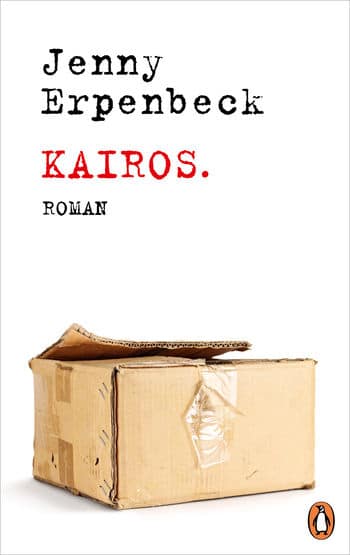 Bild: Penguin Verlag
Bild: Penguin VerlagDen Uwe-Johnson-Preis 2022 erhielt Jenny Erpenbeck für ihren Roman „Kairos“. Wir haben mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags einen Auszug daraus veröffentlicht.
Wie wird die Diskussion um das Erzählen gegenwärtig geführt?
In der Gegenwart sind wir bei sehr diffizilen Fragen, die sich immer weiter zugespitzt haben. Stichwort „kulturelle Aneignung“: Soll es Autorinnen und Autoren versagt sein, sich des historischen Materials und der Geschichte von Personen zu bemächtigen, zu deren „Gruppe“ sie nicht gehören? Dies hat vor fast 20 Jahren bereits Norbert Gstrein problematisiert, der für seinen Roman „Das Handwerk des Tötens“ 2003 den Uwe-Johnson-Preis erhalten hat. Ihm ist vorgeworfen worden, dass er sich einer fremden Geschichte bemächtigt hat. Einer Geschichte, die nicht die seine war. Gstrein hat dieses Denken in Zuständigkeiten, die sich aus der „Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu einer Gruppe“ ergeben, abgelehnt. Literatur ist eben nicht zuletzt Umverteilung von Erfahrung, und das ist etwas, was das Lesen so faszinierend macht. Wenn Leute den Anspruch auf eine Geschichte erheben wie auf einen Besitz, meint Gstrein damals, dann würde man dem Nicht-Erzählen das Wort reden und ein möglicherweise flächendeckendes Schweigen provozieren. Ich glaube, er hat Recht.
In seinen „Vorschlägen zur Prüfung eines Romans“ erwähnt Uwe Johnson den anderen, unterschiedlichen Blick eines Romans. Dazu haben Sie einmal geschrieben, dass es nicht nur darum geht, den unterschiedlichen Blick zu tolerieren, sondern dass jener die Grundlage moralischer und ästhetischer Existenz ist. Was haben Sie damit gemeint?
In dem Augenblick, da ich davon ausgehe, dass meine Position die richtige ist, verliere ich die Fähigkeit, mich mit dem Gegenüber auszutauschen. Insofern ist der Ansatz der Toleranz und das Tolerieren einer anderen Position die Grundlage von menschlichem Zusammensein. Ich erinnere an Lessings „Nathan der Weise“. Selbstverständlich gibt es Positionen, über die wir nicht diskutieren müssen, etwa wenn es um faschistoide Tendenzen im klassischen Sinne geht. Aber ohne zu versuchen, „die andere Seite mit ihren eigenen Augen zu sehen“, wie das Uwe Johnson gesagt hat, wird man keine Gespräche führen können, und in literarischen Texten erzeugen „einfache Wahrheiten“ nichts anderes denn Klischees. Darüber hinaus erscheint es mehr als problematisch, die eigenen Werte – so gut sie gemeint sein können – gewissermaßen zu „exportieren“. Das ist – ich sage das mal pointiert – Hybris und das Gegenteil von Dialog. Die moralische Existenz bezieht sich also auf den Autor oder die Autorin selbst, aber nicht auf den Text.

Der Uwe-Johnson-Preis würdigt deutschsprachige Autorinnen und Autoren, in deren Schaffen sich Bezugspunkte zu Johnsons Poetik finden und die die deutsche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reflektieren. Der Uwe-Johnson-Preis wurde 1994 erstmals verliehen. Er wird von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft e.V. gemeinsam mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR und der Kanzlei Gentz und Partner gestiftet und im jährlichen Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis vergeben.
Worauf bezieht sich die ästhetische Existenz?
Ästhetische Existenz bedeutet nicht zuletzt, dass gerecht mit den Figuren umgegangen wird. Es gibt in den „Mutmassungen über Jakob“ von Uwe Johnson einen Hauptmann der Stasi, Hauptmann Rohlfs. Johnson bekennt, dass er zunächst einen auktorialen, also einen überschauenden und kommentierenden Erzähler, einsetzen wollte. Aber der hätte die Sicht von Rohlfs möglicherweise zu kritisch, zu ironisch, zu feindlich wiedergegeben und eine moralische Bewertung gleich mitgeliefert. So etwas würde der Figur schaden, und daher wurde, sagt Johnson, aus Herrn Rohlfs ein innerer Monolog. Diese Gerechtigkeit des Erzählers gegenüber den Figuren vermisse ich in der Gegenwartsliteratur oftmals. Nicht selten finden sich Figuren, denen von Anfang an ein Negativmarker aufgedrückt wird und die der Erzähler moralisch desavouiert. Das können Figuren sein, deren Haltungen dem Autor oder der Autorin nicht passen oder von denen er glaubt, sie würden keine – meinetwegen – politisch korrekte Position vertreten. Uwe Johnson war da ganz klar, und damit kommen wir auf Ihre Eingangsfragen zurück. Für Johnson war die „Lieferung einer Moral“ der Bruch des Vertrages zwischen Autor und Leser.
Das setzen Sie auch mit dem Uwe-Johnson-Preis um?
Beim Uwe-Johnson-Preis ist uns etwas immer ganz wichtig gewesen: dass Johnson ein Erzählen jenseits der „einfachen Wahrheiten“ praktiziert. Dass für ihn Erzählen so etwas ist wie ein „Prozess der Wahrheitsfindung“. Mit dem Roman oder dem literarischen Text ist ein Angebot gemacht. Die Leser werden im Sinne von Uwe Johnson eingeladen, die im Roman angebotene „Version der Wirklichkeit“ mit jener zu vergleichen, die „Sie unterhalten und pflegen“. Und dann kommt dieser wichtige Satz über den wir schon sprachen. „Vielleicht“, fragt Johnson zurückhaltend, „passt der andere, der unterschiedliche Blick in die Ihre hinein“. Diese Position von Johnson ist für die Gegenwart ungemein wichtig, weil sie Einfühlung, Perspektivenübernahme und Dialog voraussetzt. Die Literaturkritik und natürlich die Leserinnen und Leser sollten von daher das Angebot wenigstens erst einmal ernsthaft zur Kenntnis nehmen. Literarische Texte, könnte man mit Johnson sagen, sind nicht ein „Spiegel der Welt“ und auch nicht ihre „Widerspiegelung“. Nein und noch einmal: „es ist eine Welt, gegen die Welt zu halten“. Die „Welt“, die auf diese Weise entworfen wird, muss man nicht akzeptieren, man kann eine andere dagegenstellen. Genau das macht Literatur aus.









