Der Begriff des Palavers stammt aus Afrika. In einer kolonialen Perspektive, aus der wir uns inzwischen auch in Deutschland befreien begonnen haben, wurde damit eine Kommunikationspraxis indigener Gemeinschaften bezeichnet, deren Regeln sich den an ein „methodisches Vorgehen“ gewöhnten Europäern nicht erschloss, sodass es ihnen als ein (ganz im Wortsinne) „wildes“ Durcheinanderreden vorkam. Inzwischen ist klar, dass auch das Palaver seine Regeln hat – allerdings solche, die darauf abzielen, dass wirklich Jeder zu Wort kommt und alle Argumente eingebracht werden und Berücksichtigung finden.
Ich habe in meinem Buch zur „Radikalen Philosophie“ den Gedanken vertreten, dass derartigen elementaren Formen einer Verständigung in allen menschlichen Gruppen eine entscheidende Rolle zukommt – gegen alle Versuche, rationale Verständigung auf vorgegebene Modelle von Rationalität zu beschränken. Dieser Grundgedanke lässt sich so formulieren, dass eine wirkliche Verständigung zwischen Menschen nicht mehr erfordert, als dass alle Beteiligten das, was sie zu sagen haben, auch wirklich sagen, und das, was die anderen sagen, auch wirklich hören. Und diese Art von elementarer Verständigungspraxis habe ich mit einem erweiterten Begriff des „Palavers“ bezeichnet.
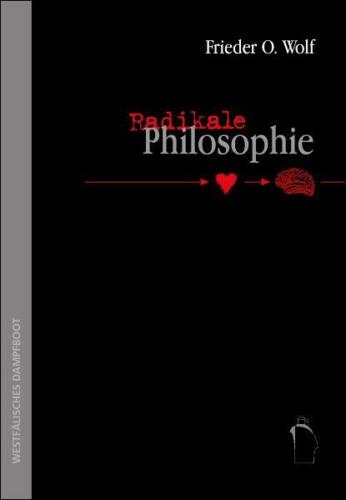
Frieder Otto Wolf: „Radikale Philosophie. Aufklärung und Befreiung in der neuen Zeit”.
Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2009
292 Seiten
ISBN: 978–3‑89691–498‑9
Ich bin davon überzeugt, dass diese elementare Praxis eines Sich-Aussprechens und Zuhörens, das vor allen vor Vereinbarungen über Regeln und Konventionen immer schon begonnen hat, jedenfalls für praktische Humanistinnen und Humanisten von geradezu grundlegender Bedeutung ist – denn sie stellt eine immer wieder praktikable Alternative dazu dar, sich für Handlungsprobleme erst einmal eine wissenschaftliche Orientierungsgrundlage zu suchen. Nicht etwa, weil dies schlecht oder grundsätzlich praktisch nicht machbar wäre. In vielen, vor allem im weitesten Sinne technischen Bereichen machen wir das ja auch tagtäglich (auch wenn wir dabei nicht immer wieder die jeweiligen wissenschaftlichen Grundlagen rekapitulieren).
Die Bedeutung des Palavers an den Grenzen einer wissenschaftlichen Orientierung in der Lebenspraxis
Diese Praxis, die ich mit dem Begriff des „Palavers” bezeichne, macht es möglich, auch überall dort zu tragfähigen gemeinsamen praktischen Orientierungen zu finden, wo es etwa schwierig ist, die konkrete Situation, in der nach einer konkreten praktischen Orientierung gesucht wird, als solche wissenschaftlich zu erfassen.
Das kann einfach daran liegen, dass die Situation, in der zu handeln ist, übermäßig komplex ist – hier muss mensch dann im Palaver konsensuale und möglichst angemessene Formen einer Komplexitätsreduktion finden. Es kann aber auch daran liegen, dass ein ernsthafter Grundlagenstreit in den beteiligten bzw. relevanten Wissenschaften dauerhaft die Umsetzung wissenschaftlicher Einsichten verhindert, weil gar nicht klar ist, welche der miteinander völlig unvereinbaren Aussagen über die gegenwärtige Situation als Grundlage für das gemeinsame Handeln akzeptiert werden sollen. Und dies ist praktisch in allen Wissenschaften der Fall, die sich auf menschliche Verhältnisse und Angelegenheiten beziehen. Als Beispiel können hier die regelmäßigen Debatten über die ökonomische Lage und ihre absehbaren Entwicklungstendenzen dienen – die von Diagnosen grundlegender Krisen bis zu bloß konjunkturbezogenen Empfehlungen reichen, über die offenbar in absehbarer Frist keine Verständigung unter den beteiligten Wissenschaftler*innen erzielt werden kann. Auch hier müssen wirtschaftspolitische Entscheidungen in einem offenen politischen Prozess getroffen werden, der strukturell alle Merkmale des Palavers trägt (mit dem einzigen, aber wichtigen Unterschied, dass hier und heute, selbst in demokratisch verfassten Gemeinwesen, nicht jede und jeder zu Wort kommt und auch das Gewicht der dann überhaupt Beteiligten bei der Entscheidungsfindung dann keineswegs gleich, sondern durchaus ungleich ist – wie dies etwa jede Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und Unternehmen sinnfällig vor Augen führt). Auffällig ist hier der Unterschied zu den Debatten über die Klimakrise oder die Corona-Pandemie, in denen es zwar auch Streit gibt, aber doch – von „freaks” abgesehen, die in der ernsthaften Debatte nicht ernst genommen werden – keinen Grundsatzstreit über die wissenschaftlichen Methoden und die mit ihnen gewonnenen Erkenntnisse.
Für eine offene Verständigung unter praktischen Humanist*innen
Der praktische Humanismus besteht angesichts dieser Debattenlage auf der schlichten Frage, wie in Bezug auf diese unübersehbaren Krisenprozesse erst einmal praktische Lösungen gefunden werden können, durch die zumindest die Auswirkungen der laufenden destruktiven Entwicklungen auf die Schwächsten abgewehrt oder abgemildert werden können – und vor allem auch Zeit gewonnen werden kann, um sich über adäquatere und gründlichere Lösungsansätze für diese Probleme verständigen zu können. Das bedeutet für alle Menschen, die im Sinne des „praktischen Humanismus” agieren, dass jedenfalls in denjenigen Bereichen der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft, welche sich auf die großen Krisen beziehen, in welche die Menschheit offenbar gerade hineinsteuert – in den Bereichen also, in welchen es darum geht, zu klären, welche tiefergehenden, „strukturellen” Veränderungen nötig sind, um diese Krisen nachhaltig zu überwinden, eine ganz reale Schwierigkeit: Einerseits wissen sie – und werden darin auch durchaus zu Recht durch die Erfahrungen im Umgang mit der Klimakrise oder mit Covid-19 bestärkt –, dass es nötig wäre, für die langfristigen Handlungsperspektiven aller aktiv Beteiligten tragfähige wissenschaftliche Grundlagen zu gewinnen; andererseits wissen sie aber auch, dass die einschlägigen Wissenschaften so tief zerstritten, ja sogar gespalten sind, dass von ihnen keine gemeinsam zu tragende Handlungsperspektive zu erwarten ist.
Hier hat der praktische Humanismus eine tragfähige Alternative anzubieten – und zwar ohne dabei die Fortführung der grundsätzlichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen behindern zu müssen, die vielleicht doch noch zu Klärungen führen werden. Diese Alternative besteht einfach darin – was in der Praxis jedenfalls in Ansätzen ohnehin passiert, wenn es „gut läuft” – „auf Sicht zu fahren”, d.h. erst einmal Schäden und Probleme anzugehen, die sich offensichtlich stellen. Und zwar durchaus in humanistischer Zuspitzung, indem mensch damit beginnt, die Problem der Ärmsten und am meisten Bedrohten vorrangig zu lösen, oder wo dies nicht unmittelbar möglich ist, jedenfalls ernsthaft zu „mildern”.
Ein solcher Ansatz bleibt grundsätzlich offen für zusätzliche Erkenntnisse über akute Problemlagen, ihre Hintergründe und deren Entwicklungstendenzen – bleibt also rational offen für die Ergebnisse der wissenschaftlichen Debatten ebenso wie für den politischen Austausch über praktische Erfahrungen.
Damit wir als Humanist*innen dazu in der Lage sind – bzw. uns immer wieder die Fähigkeit dazu aneignen können –, ist es die allererste Bedingung, dass wir uns auf die Pluralität der Perspektiven und Stimmen einlassen, mit welchen gegenwärtig Menschen auf die Herausforderung der großen Krisen antworten, vor denen die Menschheit heute steht. Damit dies aber nicht in einer bloßen Kakofonie vielfältig unterschiedlicher Stimmen endet, müssen wir gleichzeitig von Anfang an eine Arbeit der Unterscheidung leisten – ich denke, zwischen denjenigen Stimmen, die sich in der Tat auf eine solche offene Debatte einlassen und denjenigen, welche von vorneherein auf Überwältigung und Manipulation zielen. Dabei wird es nicht reichen – wie das Beispiel der Corona-Debatte schmerzhaft lehrt –, den Beiträgen „von oben” schlicht diejenigen „von unten” entgegenzusetzen, sondern alle Beiträge sind immer auch daran zu prüfen, ob sie sich ernsthaft auf den Stand der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse beziehen. Das ist selbstverständlich angesichts der gegenwärtigen ökonomischen und ökologischen Krisen ein schwieriges und geradezu heikles Unterfangen – ebenso angesichts der erneut wachsenden Gefahr einer militärischen Austragung von Konflikten. Aber einfacher lassen sich tragfähige praktische Orientierungen auch für praktische Humanist*innen in der vielfach kritischen Lage der Gegenwart nicht gewinnen









