Die insgesamt 19 Kapitel des Buches setzen stets mit filmischen Beispielen ein – I, Robot; Matrix, Ex Machina, Blade Runner u.a. – und entfalten davon ausgehend unterhaltsam ihr jeweiliges Thema: Digitale Simulation von Gefühlen, Warum KIs nicht denken können, Zur Ethik der Kommunikation im Internet, Die Utopie der Liquid Democracy, Die transhumanistische Versuchung etc. Auf diese Weise wollen die Literaturwissenschaftlerin und Filmtheoretikerin Nathalie Weidenfeld und der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Julian Nida-Rümelin die „trockene philosophische Analyse mit fiktionalen Welten“ verbinden, um das Ganze „erfahrungsgesättigter und lebensnaher zu machen“ (S. 14). Die filmischen Beispiele – das muss man sich als Leserin oder Leser klarmachen – dienen dabei nicht als Belege für die vertretenen Thesen, sondern zu deren Illustration.
Das humanistische Kernstück des Buches ist das Anliegen, angesichts von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz einen bleibenden kategorialen Unterschied von Mensch und Maschine, von Gehirn und Computer, zu begründen. Maschinen können nicht empfinden, nicht entscheiden, nicht denken und keine moralischen Urteile fällen. Sie können – so Nida-Rümelin und Weidenfeld – all das nur simulieren. Ava gaukelt Caleb in Ex Machina Gefühle vor, sie hat aber nicht wirklich welche und versteht auch nicht, was es heißt, Gefühle zu haben (Kapitel 3). In Matrix kann Neo am Ende eine von Gründen geleitete Entscheidung treffen, er ist nicht wie die Maschinen ausschließlich den Gesetzen der Kausalität unterworfen (Kapitel 4). Der Astronaut Dave stirbt am Ende von 2001: Odysee im Weltraum, weil sich unsere komplexe ethische Verständigungspraxis des Gebens und Nehmens von Gründen, die ein eigenständiges Erfassen von Sinn und Bedeutung impliziert, nicht algorithmisieren lässt: Der Bordcomputer HAL bricht das Gespräch ab (Kapitel 11). Vielleicht lässt sich dies – expliziter als im Buch – fassen als die notwendige Unterscheidung von einerseits „Intelligenz“, die auch Computer und Roboter haben können, und andererseits „Bewusstsein“ (als „verkörpertes“ zu verstehen), das mehr ist als Intelligenz und das Maschinen nicht haben können.
Zusammen mit dem Simulationsargument, das im Übrigen nicht ausschließt, dass Maschinen manche Dinge besser und schneller erledigen können als Menschen (z.B. Verarbeitung großer Datenmengen oder Berechnungen), spielt im Buch die Grundannahme einer weitgehenden „Unveränderlichkeit der Menschennatur“ (S. 206) bzw. der menschlichen Lebensform eine zentrale argumentative Rolle: Menschen haben spezifische natürliche Eigenschaften, die sich auch durch Digitalisierung nicht ändern. Dieser relativ starke essentialistische Grundzug wird unter Humanistinnen und Humanisten zu diskutieren sein. Gerät so nicht aus dem Blick, dass auch das Verständnis des „Menschlichen“ sich historisch ändern kann? Dass z.B. der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, sich unter Verkümmerung des heute als „menschlich“ Geltenden durchaus in Richtung „Maschine“ entwickeln kann? Was sich ja durchaus schon manchmal beobachten lässt. Wir hätten dann nicht etwa Maschinen gebaut, die Menschen simulieren, sondern die Menschen hätten sich ein Beispiel an den Maschinen genommen.
Wenn Nida-Rümelin und Weidenfeld über die „Silicon-Valley-Ideologie“, die „Digitalisierungsideologie“ oder die „KI-Ideologie“ schreiben, so laden sie uns sinnigerweise zum Nachdenken darüber ein, ob diesen nicht die irrige Annahme einer vollständigen Mathematisierbarkeit der Welt und des menschlichen Lebens zugrunde liegt. Den „digitalen Humanismus“ sehen sie als eine Alternative zu diesen „Ideologien“, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Jenseits von Technikeuphorie und Technikfeindschaft gehe es um „menschliche Autorschaft“: Dass Menschen die Möglichkeiten der Technik ethisch bewusst für sich nutzen, anstatt sich ihr zu unterwerfen. Das ist natürlich nicht neu, aber auch nicht deswegen falsch.
Gelegentlich scheinen die philosophischen Ausführungen etwas zu sehr im Modus des Behauptens oder Sollens („wir sollten …“) und Dürfens („wir dürfen nicht …“) gehalten zu sein. Was z.B. im Kapitel 4 zur Willensfreiheit hervortritt: Dass die Verneinung des Vorhandenseins von Willensfreiheit nicht unseren Gefühlen, unserem Selbstbild oder unserer Lebensform entspricht, ist ja nicht ohne weitere Erklärungen ein Beleg für ihr Vorhandensein, denn wir können uns über uns täuschen. Hier wird man zusätzlich auf andere einschlägige Publikationen von Nida-Rümelin zurückgreifen müssen. Das Buch hat einführenden Charakter und liefert als solches reichlich Denkanregungen. Wer sich mit den „digitalen Themen“ schon intensiver beschäftigt hat, wird aber eher von den philosophischen Erörterungen in humanistischer Perspektive profitieren können. Diese wiederum sind stellenweise anspruchsvoll, aber hier – und das ist gut so – nicht zugeschnitten auf philosophisches Fachpublikum.
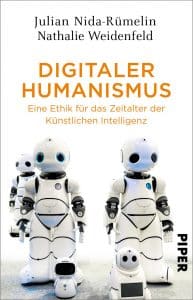
Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld:
Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
Erschienen im Piper Verlag
224 Seiten, Broschur, € 12
ISBN: 978–3‑492–31616‑3









